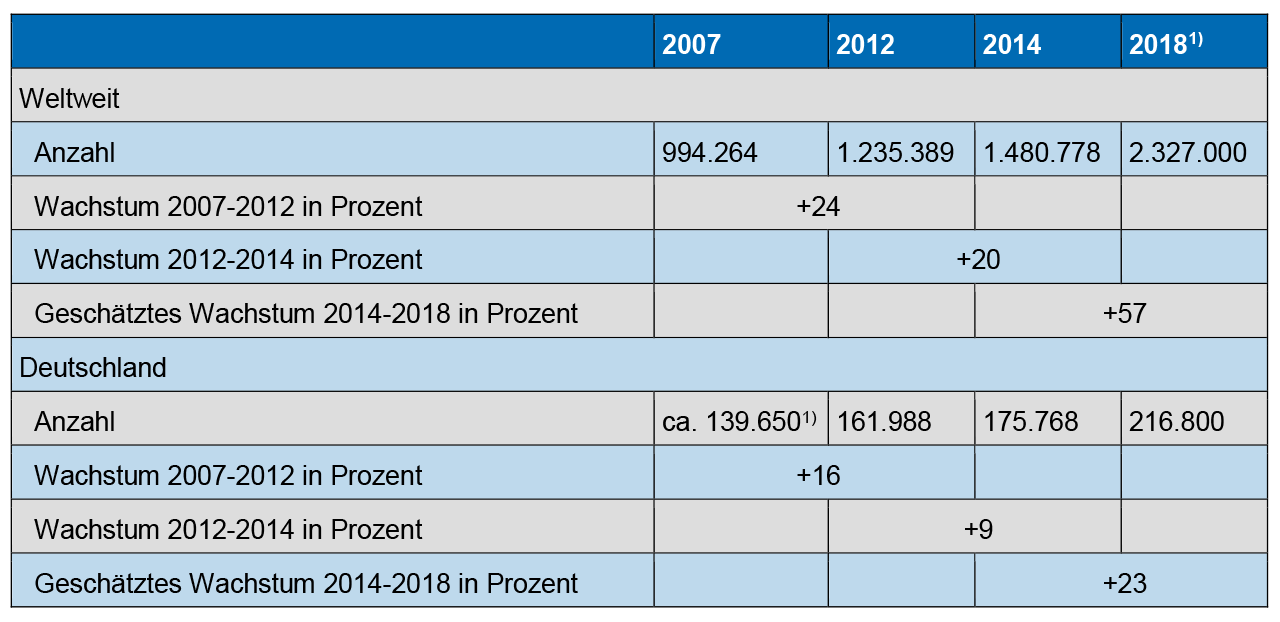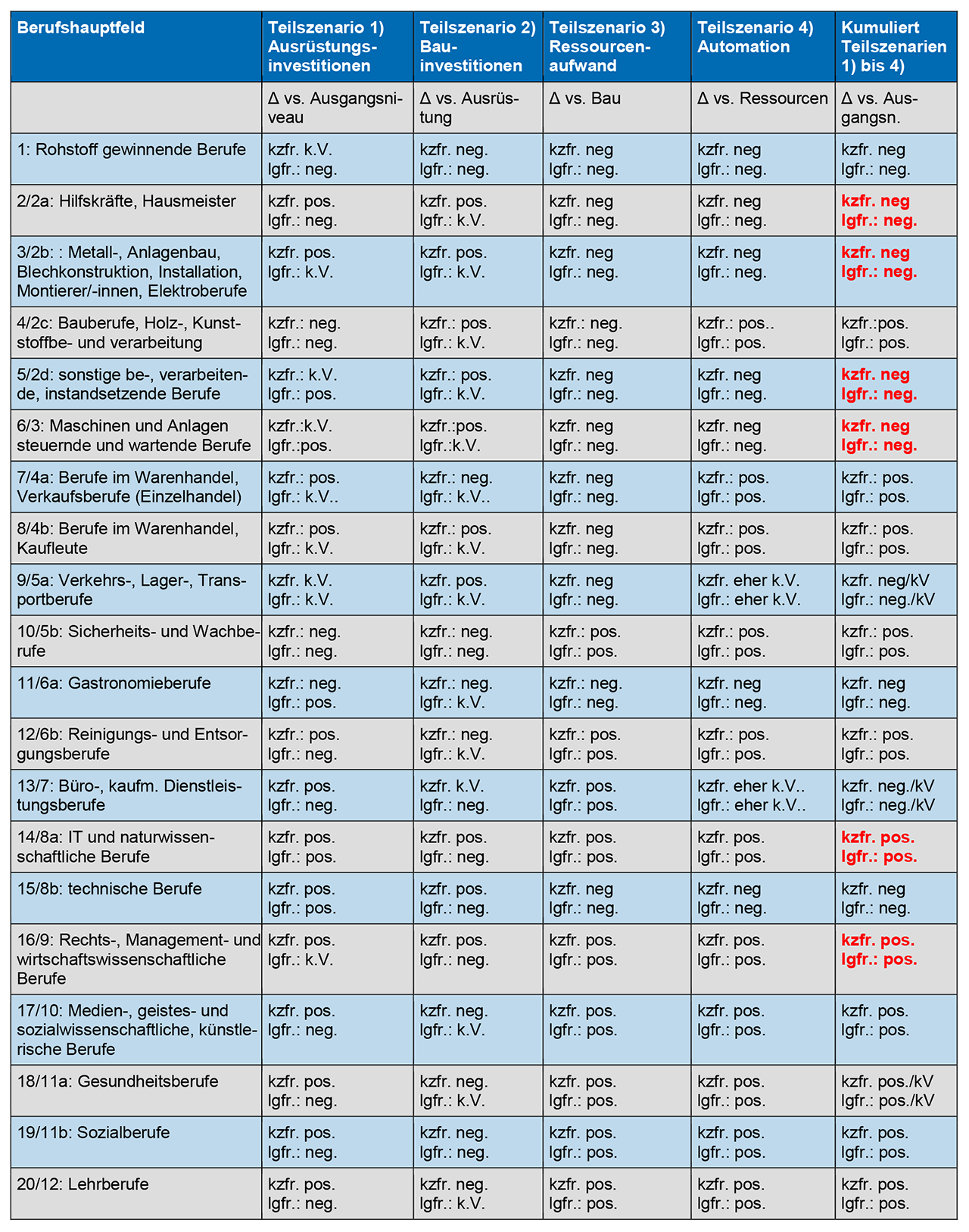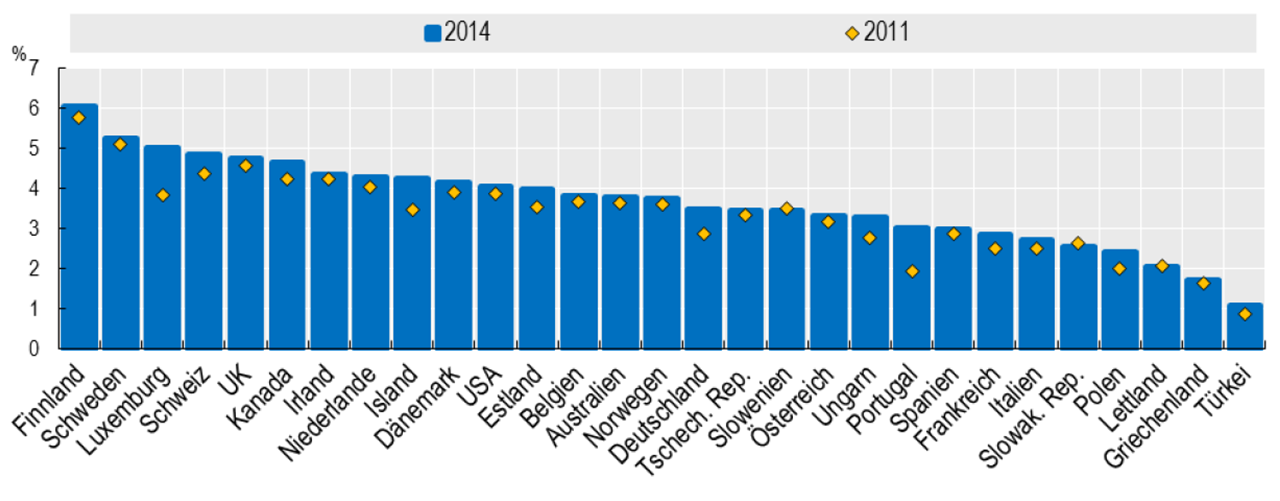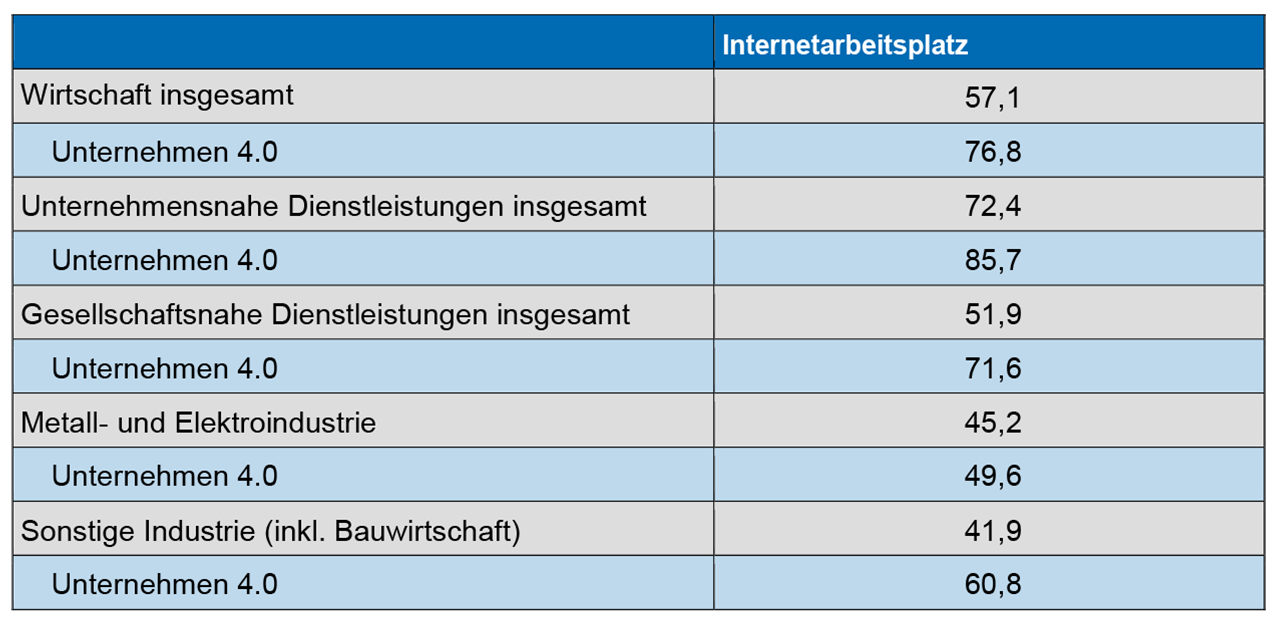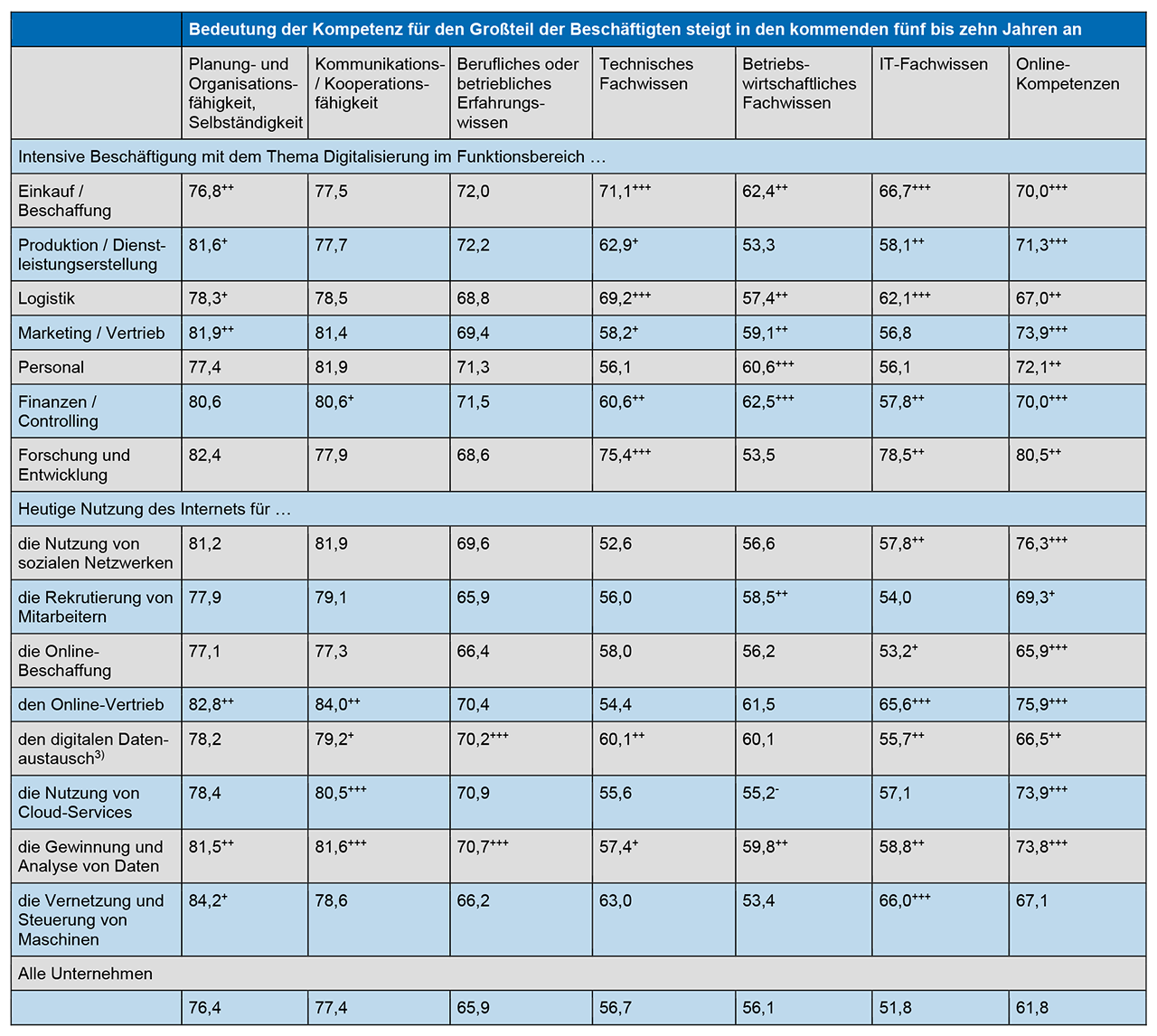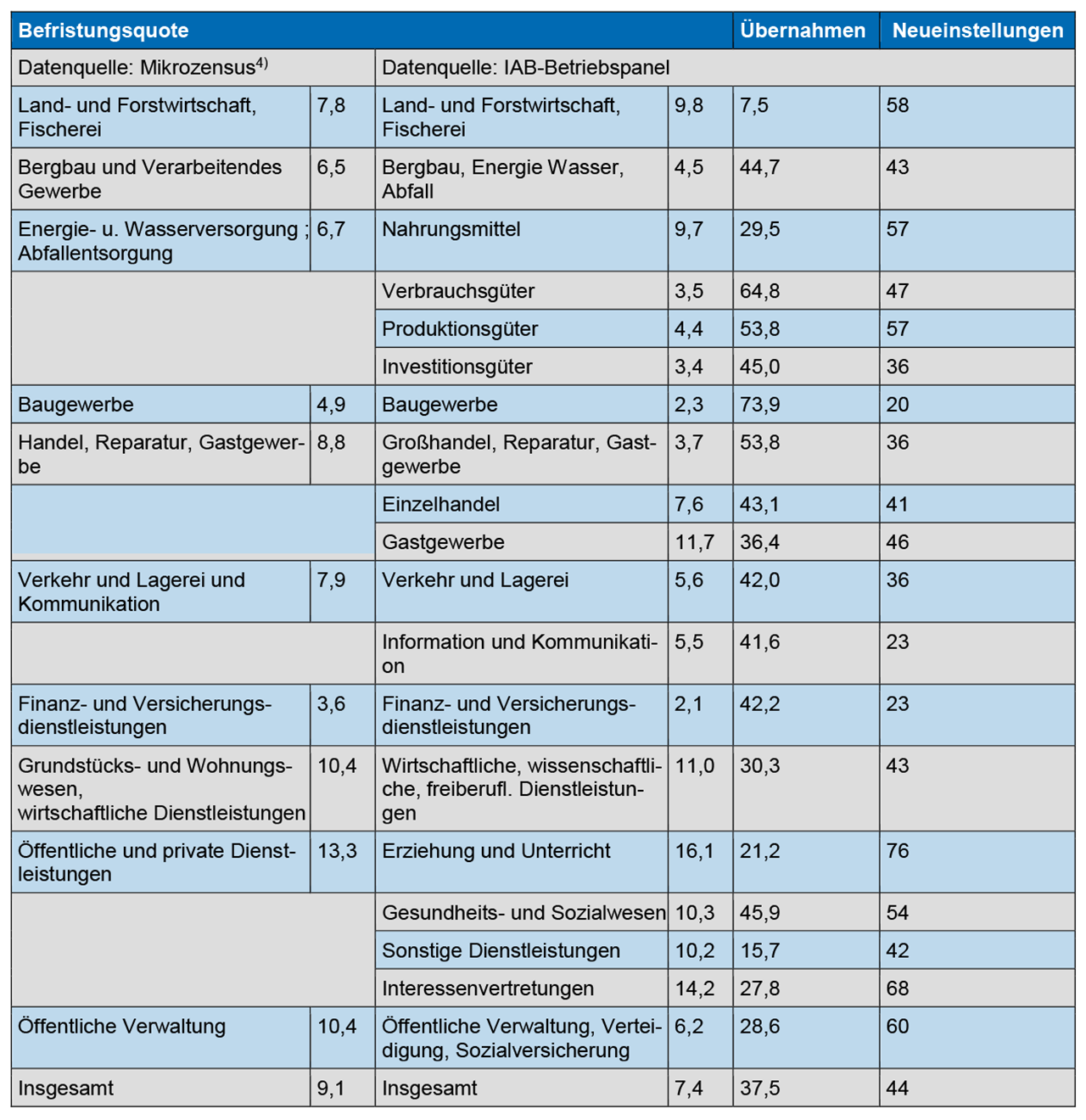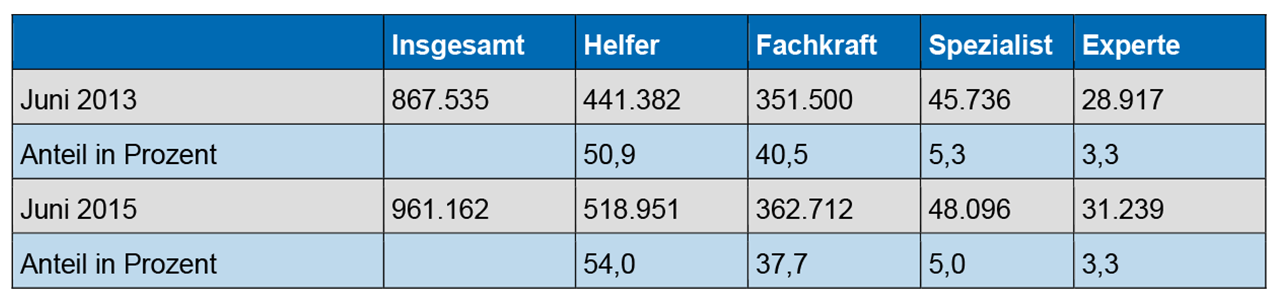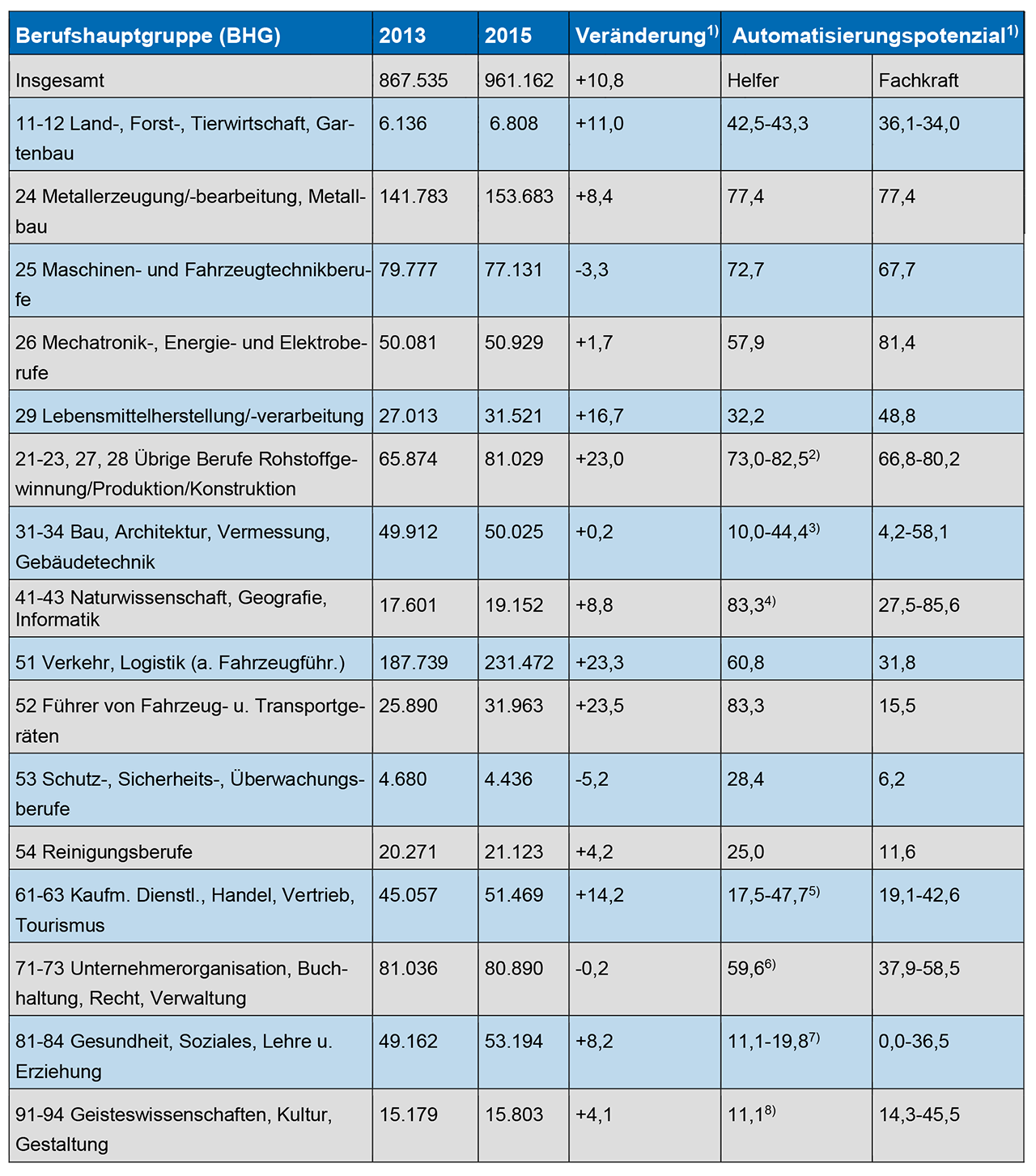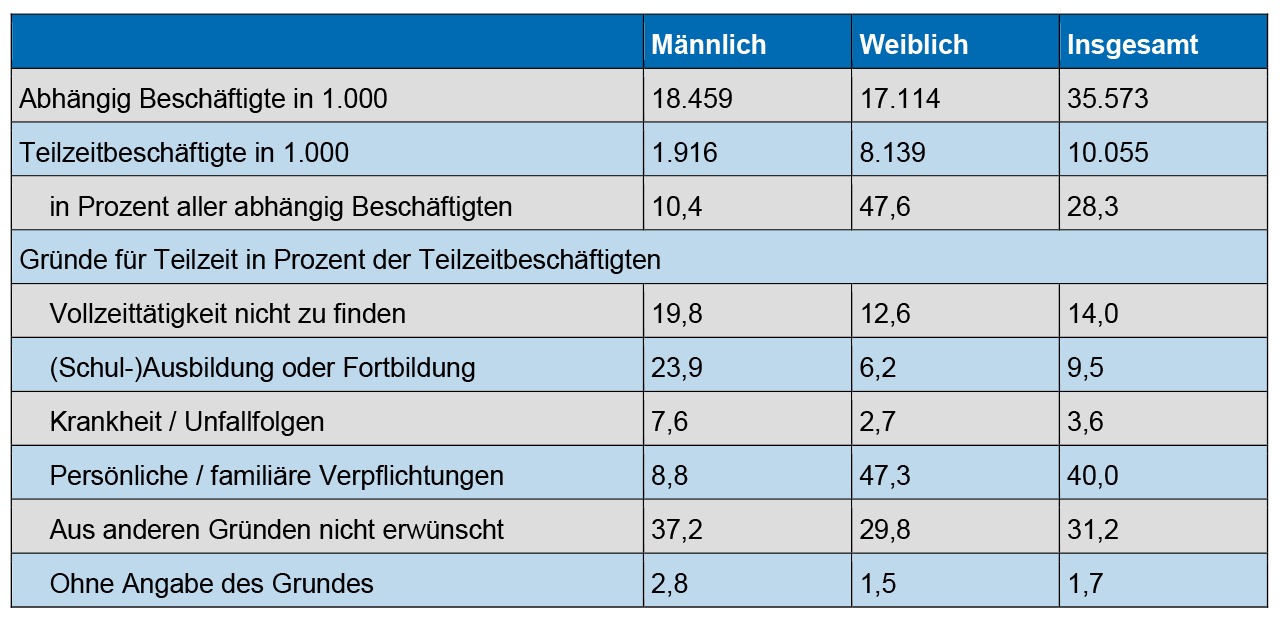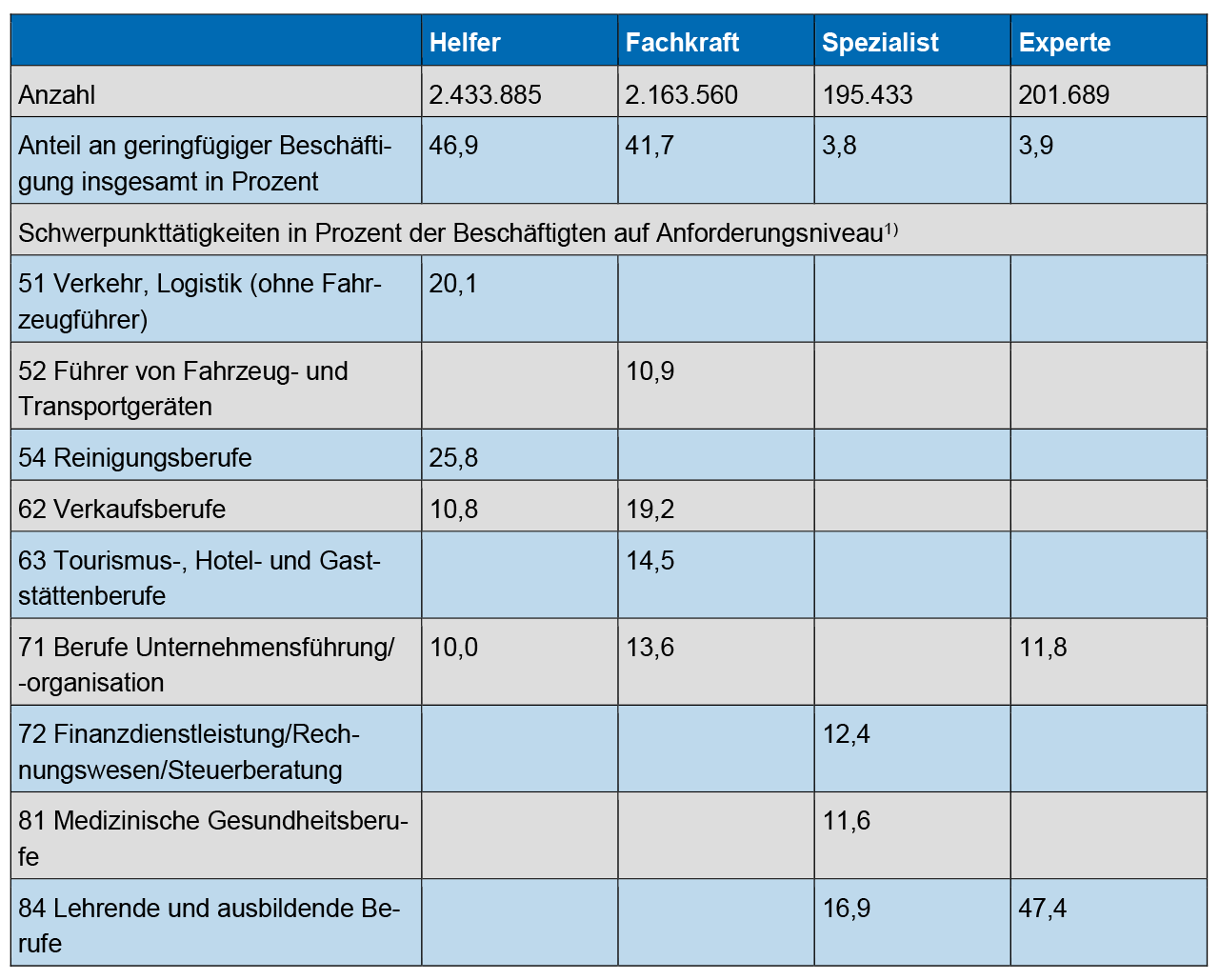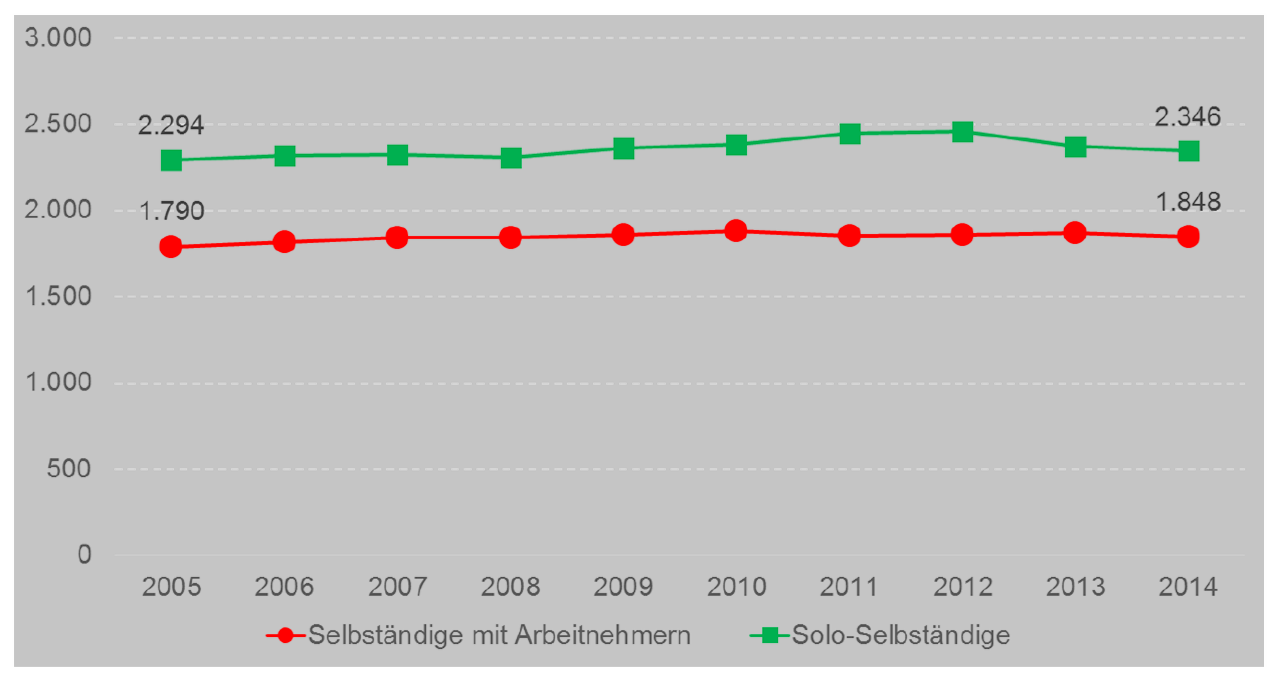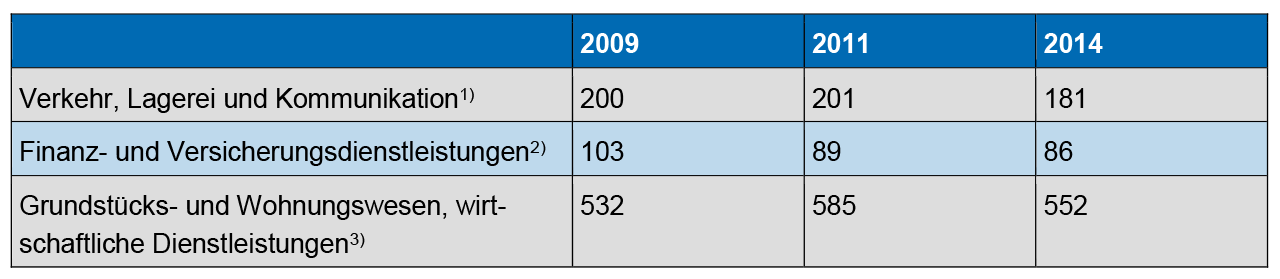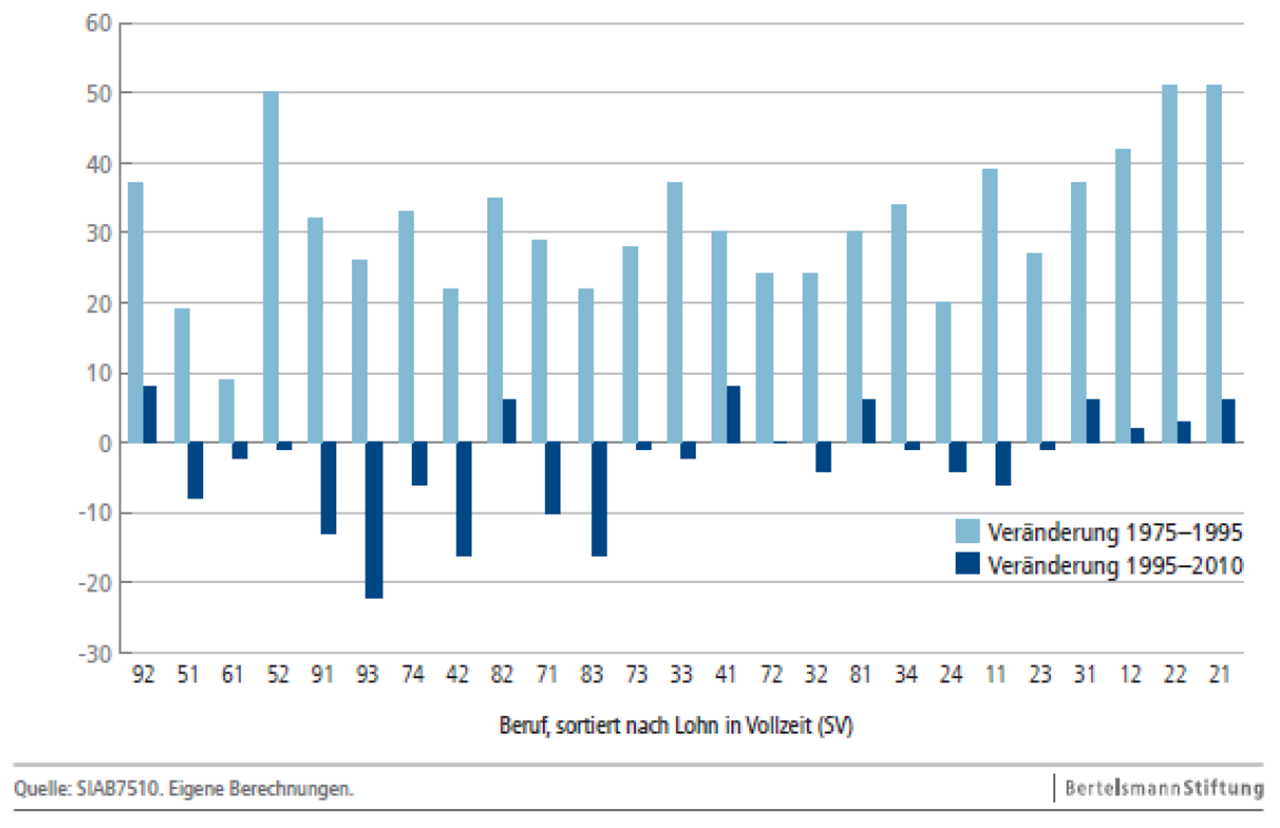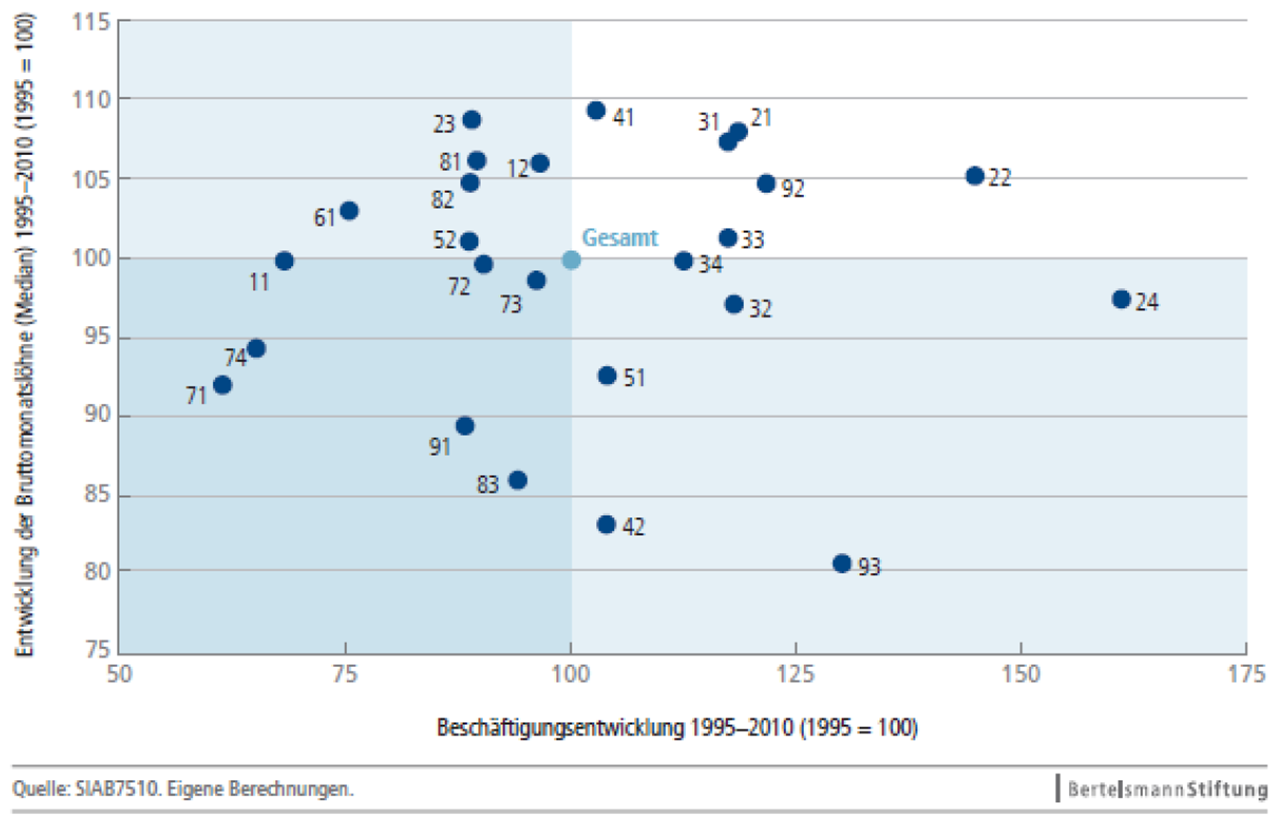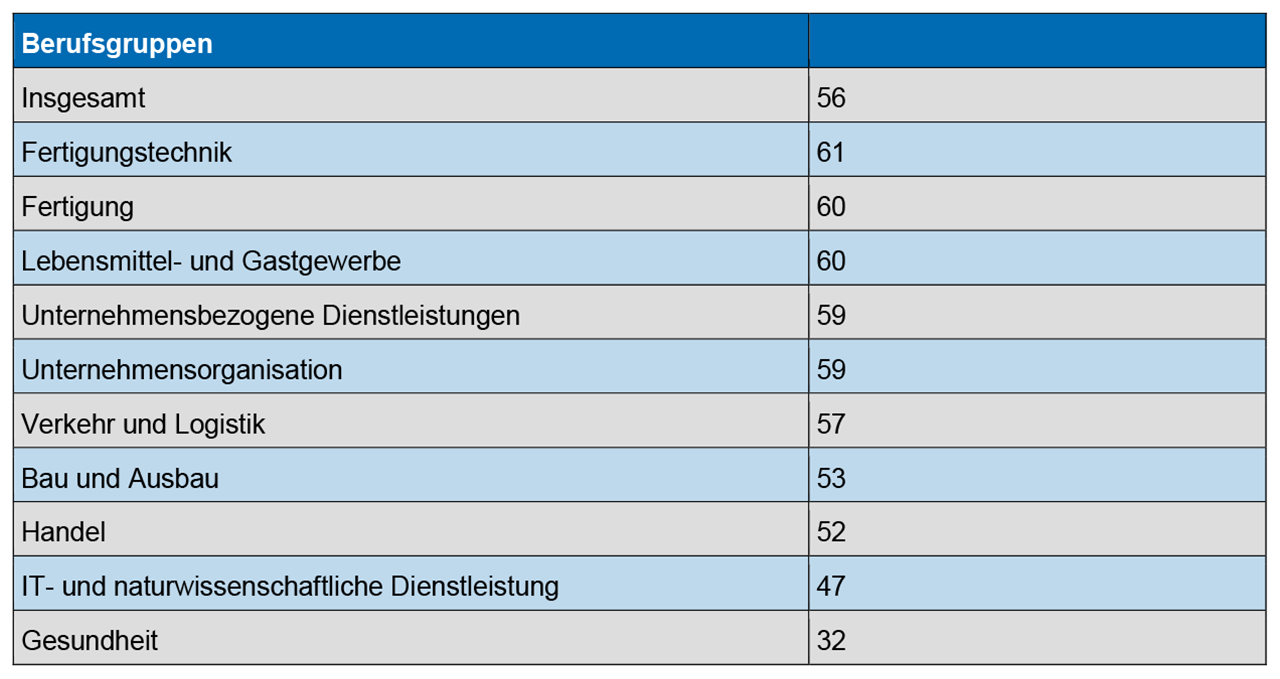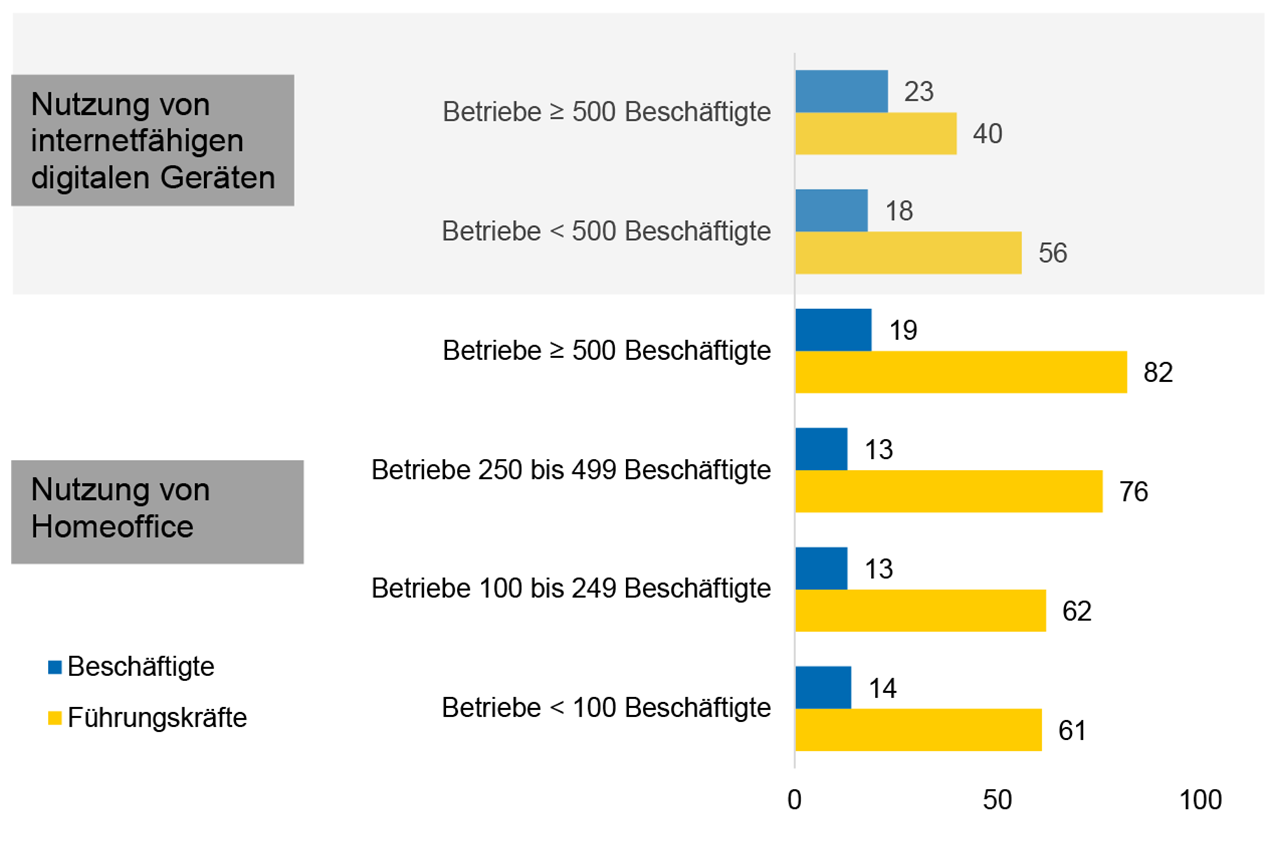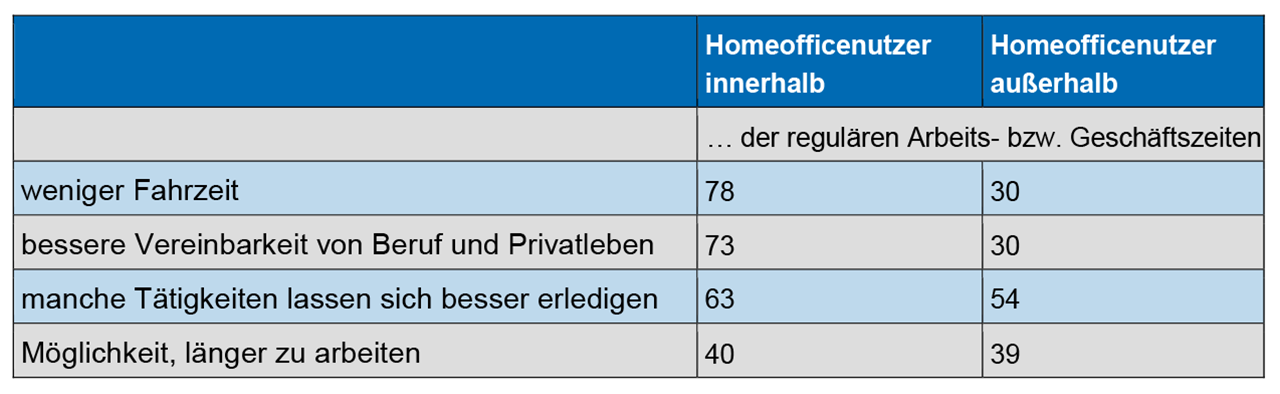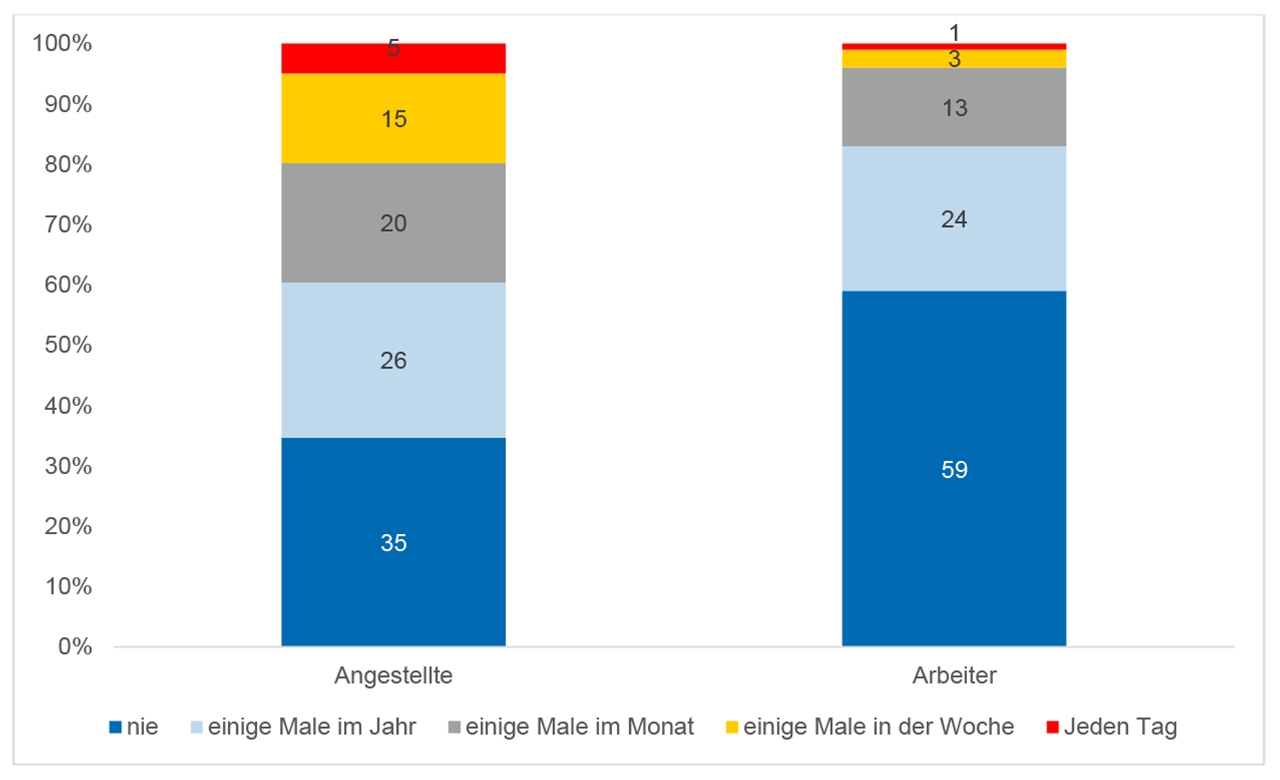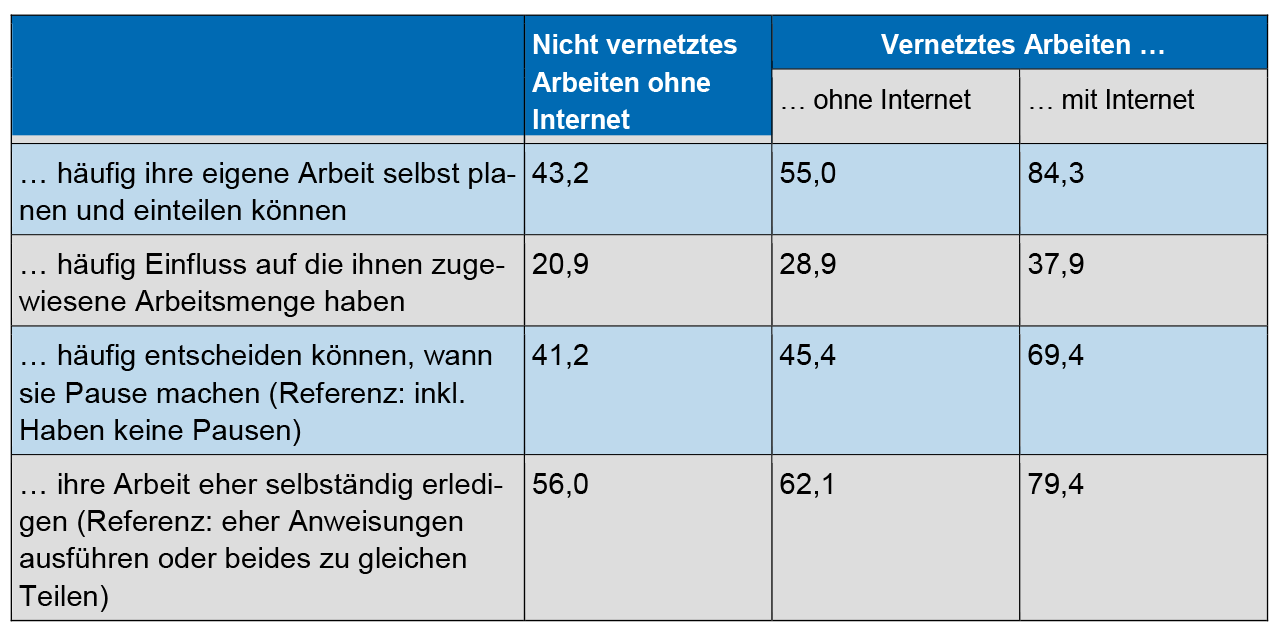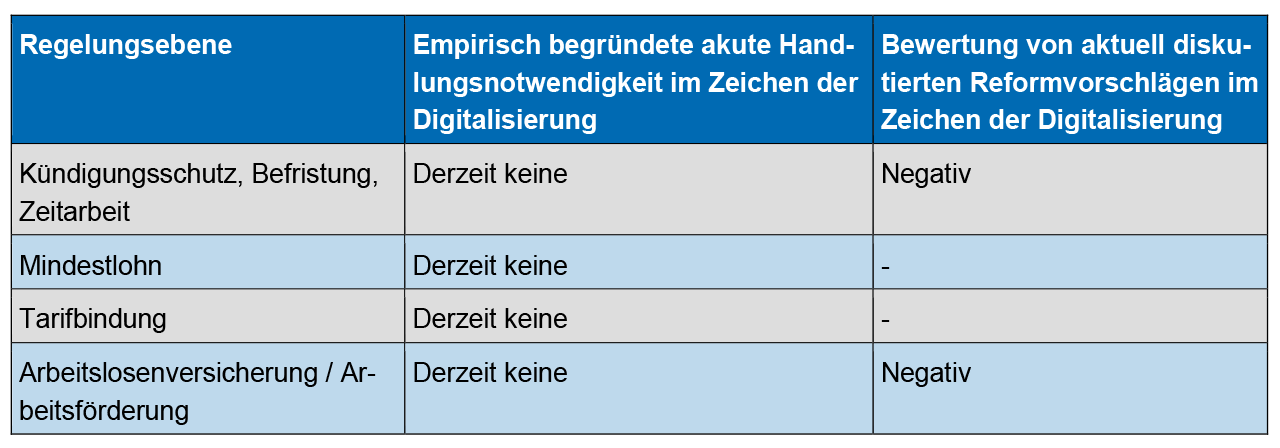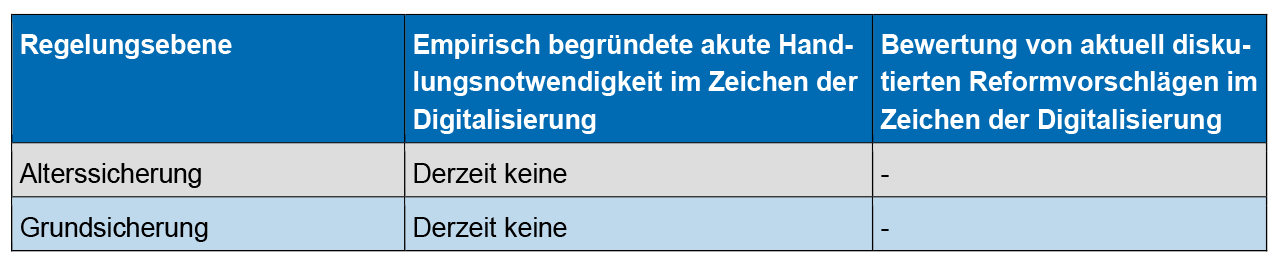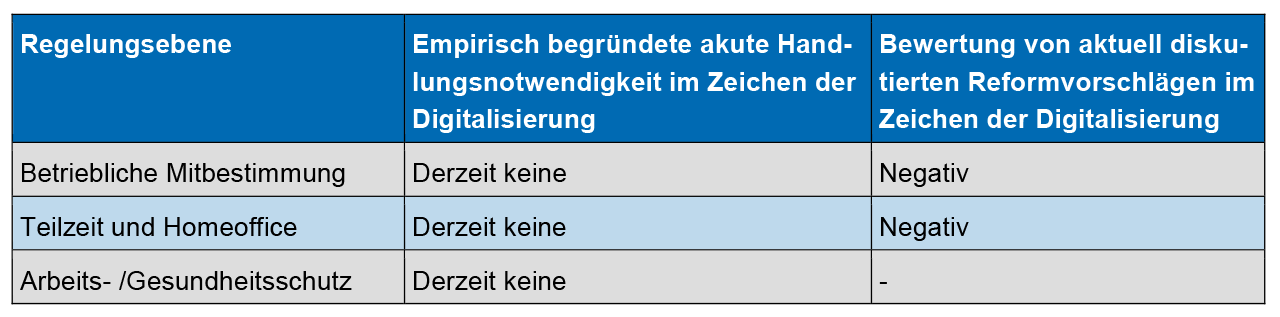Studie: Wie die Arbeitswelt der Zukunft aussieht
Müssen im Zuge einer fortschreitenden Digitalisierung negative Beschäftigungsentwicklungen befürchtet werden? Die vorliegende Studie "Arbeitswelt und Arbeitsmarktordnung der Zukunft" von Dr. Oliver Stettes (IW Köln) zeigt dafür keine empirischen Anhaltspunkte. Manch anderes wird sich dafür grundlegend ändern.
9. Juni 2016Studie HerunterladenINSM-Position Arbeit 4.0Pressemeldung zur StudieKampagne "Große Aufgaben"
2. Wie sieht der Arbeitsplatz der Zukunft aus?
2.1. Beschäftigungseffekte der Digitalisierung
2.1.1 Automatisierung und Rationalisierung
2.1.2 Sektoraler und gesamtwirtschaftlicher Wandel
2.1.3 Arbeitsanforderungen in der digitalisierten Wirtschaft
2.1.4 Zwischenfazit I
2.2 Beschäftigungsformen in einer digitalisierten Arbeitswelt
2.2.1 Befristung und Zeitarbeit
2.2.2 Teilzeit und Minijobs
2.2.3 Solo-Selbständigkeit und Crowdworker
2.2.4 Zwischenfazit II
2.3 Arbeitsbedingungen in einer digitalisierten Arbeitswelt
2.3.1 Qualität der Arbeit – materielle Komponenten
2.3.2 Qualität der Arbeit – immaterielle Aspekte
2.3.3 Zwischenfazit III
3. Arbeitsmarktordnung im Zeichen des digitalen Wandels
3.1 Die Regulierung der materiellen Arbeitsbedingungen
3.2 Ausgestaltung des Sozialstaates
3.3 Die Regulierung der immateriellen Arbeitsbedingungen
4 Fazit
Zusammenfassung
Die Digitalisierung der Wirtschaft und Arbeitswelt und damit die zunehmende Verbreitung und Vernetzung von modernen Informations- und Kommunikationstechnologien werfen die Frage auf, wie wir in Zukunft arbeiten werden und welche Beschäftigungsperspektiven sich für welche Beschäftigtengruppen damit verbinden. Im Raum steht die Hypothese einer fundamentalen Transformation der Arbeitswelt, wodurch bei vielen Ängste und Befürchtungen geweckt werden. Es überrascht daher wenig, dass die Politik (sich) den Prüfauftrag erteilt hat, ob der institutionelle Rahmen für den Arbeitsmarkt und den Sozialstaat auch noch zu einer digitalisierten Arbeitswelt und Wirtschaft passt. Die derzeit vorhandene empirische Evidenz spricht allerdings wenig für dringenden Handlungsbedarf, sondern vielmehr für Zurückhaltung und Abwarten.
So finden sich bislang keine überzeugenden empirischen Anhaltspunkte dafür, dass im Zuge einer fortschreitenden Digitalisierung negative Beschäftigungsentwicklungen befürchtet werden müssen. Dies gilt selbst für jene Beschäftigtengruppen, bei denen man aufgrund der potenziellen Automatisierbarkeit der Tätigkeiten am ehesten Beschäftigungseinbußen vermuten würde. Es ist allerdings zu erwarten, dass die Digitalisierung die Entwicklung zur Höherqualifizierung weiter vorantreibt, die bereits in den vergangenen Dekaden am deutschen Arbeitsmarkt zu beobachten war. Die Unternehmen sind sich ihrer Verantwortung jedoch bewusst, den Beschäftigten die Möglichkeit zu eröffnen, die erforderlichen Kompetenzen aufzubauen, zu erhalten oder weiter zu entwickeln.
Befristete Beschäftigung und Zeitarbeit haben sich als wichtige betriebliche Flexibilisierungsinstrumente etabliert, die den Betrieben die Möglichkeit eröffnen, Auftragsschwankungen ohne Anpassung der Stammbelegschaften abzufedern oder auf kurzfristig entstehende Engpässe an bestimmten Kompetenzen zu reagieren. Auch wenn kein direkter systematischer Zusammenhang mit der Digitalisierung existiert, darf davon ausgegangen werden, dass ihre Funktion als Instrument der betrieblichen Flexibilisierung nicht an Bedeutung verlieren wird. Auch bei Teilzeitbeschäftigung, geringfügiger Beschäftigung und neuer Selbständigkeit spricht die empirische Evidenz gegen einen systematischen Zusammenhang mit einer zunehmenden Digitalisierung. Erstere ist insbesondere von Erwägungen getrieben, die sich aus Bedingungen im privaten Umfeld der Beschäftigten ergeben. Minijobs konzentrieren sich auf Helfer- und Fachkräftetätigkeiten und dabei insbesondere auf Einsatzbereiche, bei denen das Substituierbarkeitspotenzial allenfalls als mittelhoch eingeschätzt wird. Das Phänomen der Crowdworker als neue Form der Selbständigkeit ist selbst in einer Vorreiterbranche der Digitalisierung, der Informationswirtschaft, im Grunde nicht bekannt und die Verbreitung von Solo-Selbständigkeit hat sich insgesamt kaum verändert.
Die vorhandene empirische Evidenz lässt ferner derzeit noch keinen Schluss auf die zukünftige Entwicklung der Arbeitsbedingungen zu. So ist offen, ob sich die Lohnstruktur und die Einkommensperspektiven von bestimmten Beschäftigtengruppen ausdifferenzieren. Genauso wenig absehbar ist derzeit auch, ob im Zuge einer fortschreitenden Digitalisierung der Arbeitswelt die Verbreitung leistungs-, erfolgs- und zielorientierter Vergütungsmodelle zunehmen wird. Der Dezentralisierungstrend bei Entscheidungsbefugnissen und -verantwortung könnte dies begünstigen. Aussagen der Beschäftigten legen nahe, dass Termin- und Leistungsdruck und die Anforderungen an Multitasking in einem digitalisierten Arbeitsumfeld relativ hoch sind. Allerdings weisen die Beschäftigten in einem solchen Umfeld zugleich auch über größere Handlungs- und Entscheidungsspielräume auf, die es ihnen erlauben, diese höheren Anforderungen zu bewältigen. Empirische Evidenz für eine stärkere psychische Belastungssituation findet sich daher nicht. Gleiches gilt auch für die Frage, ob die Beschäftigten durch digitale Technologien für dienstliche Belange auf unzumutbare Weise permanent in der Freizeit erreichbar sein müssen. Nur eine Minderheit der Beschäftigten wird mehrmals in der Woche kontaktiert und auch unter diesen empfindet nur eine kleine Gruppe dies als eine stark belastende Situation.
Vor diesem Hintergrund ist eine Anpassung des institutionellen Rahmens auf dem Arbeitsmarkt und im Sozialstaat voreilig, die sich zum Ziel setzt, die Beschäftigten vor vermeintlichen Gefahren der Digitalisierung zu bewahren. Im Gegenteil drohen die verschiedenen derzeit diskutierten Reformvorschläge die Anpassungsflexibilität des hiesigen Arbeitsmarktes einzuschränken, obwohl das derzeitige institutionelle Setting einen maßgeblichen Beitrag zum Aufbau der Beschäftigung und zum Rückgang der Arbeitslosigkeit geleistet hat. Eine Politik ohne solide empirische Grundlage läuft Gefahr, den beschäftigungspolitischen Erfolg der jüngeren Vergangenheit zu gefährden.
1. Einführung
Dampfmaschine, Fließband, computergestützte Maschinen - sie sind die Symbole für die vergangenen industriellen Revolutionen. Diese Innovationen haben die Art und Weise, wie wir arbeiten und wie wir Güter und Dienstleistungen produzieren, grundlegend verändert. Im 18. und 19. Jahrhundert revolutionierte die Erfindung der Dampfmaschine Textilindustrie, Schifffahrt und Eisenbahn und zog Landwirte und Handwerker vom Land in die Fabriken. 1914 wurde das Modell T von Ford in arbeitsteiligen Produktionsschritten am Fließband gefertigt. Die Elektrifizierung ermöglichte kostengünstige Massenproduktion und begründete damit die zweite industrielle Revolution. Mitte des 20. Jahrhunderts leitete die Erfindung des Computers die dritte Revolution ein. Seit Anfang der 1970er Jahre haben vermehrt auch das Internet und Robotertechnologien Einzug in die Fabriken gehalten.
Internet der Dinge, cyber-physische Systeme, big data und clouds - auch die Digitalisierung der Wirtschaft wird mit Symbolbegriffen verbunden. Sie stehen weniger für eine bestimmte Technologie als vielmehr für die Kombination und Interaktion mehrere Technologien. Ihnen wird das Potenzial zuerkannt, Arbeitswelt und Beschäftigungsperspektiven fundamental zu verändern. Die Digitalisierung wird daher häufig nicht als stetiger Prozess, sondern eher als radikale Umwälzung verstanden. Es verwundert daher wenig, dass unter solchen Bedingungen dann in der öffentlichen Diskussion vor allem Szenarien Konjunktur haben, bei denen die bestehenden und gegebenenfalls bewährten Strukturen auf den Prüfstand geraten. Die mediale Darstellung von Bedrohungsszenarien für einen fundamentalen Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft verspricht jedenfalls mehr Aufmerksamkeit als jene von Potenzialszenarien, in denen Chancen skizziert werden.
Die Vergangenheit lehrt, dass vom technischen Fortschritt getriebene Veränderungen sich in der Arbeitswelt immer massiv auf die Nachfrage nach bestimmten Kompetenzen und Qualifikationen ausgewirkt haben. Es ist daher nachzuvollziehen, dass das Bundesarbeitsministerium (BMAS, 2015a) ein Grünbuch („Arbeiten 4.0“) vorgelegt hat, in dem insgesamt 30 Leitfragen in sechs Handlungsfeldern präsentiert werden, auf die in den kommenden Monaten eine Antwort gefunden werden soll.
Die Handlungsfelder sind:
1. Arbeit für Alle? Teilhabe an Arbeit sichern
2. Erwerbstätigkeit oder individueller Lebensrhythmus – wer gibt den Takt vor?
3. Soziale Marktwirtschaft reloaded? Gerechte Löhne und soziale Sicherheit
4. Einmal Fachkraft, immer Fachkraft? Qualifizieren für die Arbeit von heute und morgen
5. Wie arbeiten wir in der Arbeitswelt der Zukunft? Gute Arbeit im Digitalen Wandel erhalten
6. Wie arbeitet das erfolgreiche Unternehmen der Zukunft? Gute Unternehmenskultur und Demokratische Teilhabe
Bedrohungsszenarien öffnen die Tür für politischen Handeln, wo eigentlich keines erforderlich ist. Es ist zu befürchten, dass Antworten auf diese Leitfragen weniger empirischen Entwicklungen folgen, sondern vielmehr politischen Vorstellungen, wie eine Arbeitswelt aussehen sollte. Daher besteht dringender Aufklärungsbedarf in Öffentlichkeit, Wirtschaft und Politik, welche Konsequenzen der digitale Wandel haben wird. Denn, ob wir wirklich am Rande einer vierten industriellen Revolution stehen, bleibt abzuwarten.
Ziel des Gutachtens ist es, die Diskussion um die potenziellen Veränderungen der Arbeitswelt anhand von vorliegenden empirischen Ergebnissen zu versachlichen und Anhaltspunkte darüber zu geben, ob und in welchem Umfang die Sorge um negative Auswirkungen des digitalen Wandels begründet sind oder nicht. Denn Prognosen über langfristige Entwicklungen in der Arbeitswelt unterliegen einer hohen Unsicherheit, zumal sie häufig abgekoppelt von den aktuellen Bedingungen und der aktuellen Situation auf dem Arbeitsmarkt getroffen werden. Der Rückgriff auf vorhandene Daten und Fakten erlaubt dagegen eine Einschätzung, ob für die vorhergesagten Veränderungen bereits heute erste Anzeichen zu erkennen sind. Auf diese Weise werden auch Anhaltspunkte darüber gewonnen, wie die institutionellen Rahmenbedingungen gestaltet sein müssten, damit der digitale Wandel aus volkswirtschaftlicher Perspektive wohl-fahrtssteigernd wirkt und positive Beschäftigungsimpulse geben kann, gleichzeitig aber potenzielle negative Wirkungen für den einzelnen Betroffenen sachgemäß abgefedert werden können.
Die Studie gliedert sich in zwei Teile. In einem Analysekapitel wird zunächst geprüft, wie sich Beschäftigungsniveau, Beschäftigungsformen und Arbeitsbedingungen entwickelt haben und ob diese Veränderungen im Zusammenhang mit einer fortschreitenden Digitalisierung stehen. Anschließend wird darauf aufbauend diskutiert, ob überhaupt politischer Handlungsbedarf existiert und inwiefern die derzeit diskutierte Vorschläge treffsicher und effizient den Ordnungsrahmen der Arbeitswelt auf eine fortschreitende Digitalisierung ausrichten.
2. Wie sieht der Arbeitsplatz der Zukunft aus?
2.1 Beschäftigungseffekte der Digitalisierung
Wenn technischer Fortschritt weitreichende Veränderungen in Gesellschaft und Wirtschaft auslöst oder verstärkt bzw. erwartet oder vermutet wird, dass technologischer Wandel weitreichende Folgen auf Gesellschaft und Wirtschaft haben wird, werden vor allem Szenarien diskutiert, bei denen die bestehenden und gegebenenfalls bewährten Strukturen auf den Prüfstand geraten. Veränderungen des Status quo werden von den meisten Menschen jedoch mehr als Bedrohung denn als Chance wahrgenommen (Kahneman et al., 1991), und zwar umso stärker, je günstiger der Status quo von diesen eingeschätzt wird. Vor diesem Hintergrund ist es wenig erstaunlich, dass bei einer im internationalen Vergleich positiven Beschäftigungssituation hierzulande in den Medien und in der öffentlichen Diskussion Bedrohungsszenarien häufig mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen als Potenzialszenarien, in denen Chancen skizziert werden. Dies war auch zuletzt wieder zu beobachten, als auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos die Erwartung präsentiert und erörtert wurde, dass die Digitalisierung zu einem Abbau von fünf Millionen Arbeitsplätzen führen könnte. Diese Erwartung reiht sich damit in eine Reihe von Prognosen ein, denen zufolge Millionen von Arbeitsplätzen durch den von digitalen Technologien getriebenen Wandel bedroht seien (vgl. z. B. Frey/Osborne, 2013 oder ING-DiBa, 2015).
Durch die Debatte um die Auswirkungen der Digitalisierung zieht sich die uralte Angst des Menschen, sich selbst als Produktionsfaktor durch den technischen Fortschritt abzuschaffen. Im Zentrum steht dabei die Frage, inwieweit Roboter oder digitale Technologien die menschliche Arbeitskraft ersetzen und das Unternehmen der Zukunft mit vernetzten, sich selbst regulierenden Maschinen, Geräten und Produkten ohne Menschen auskommt. Daher ist es sinnvoll, in einem ersten Schritt zu überprüfen, inwieweit aus der vorliegenden empirischen Evidenz der Schluss auf positive oder negative Beschäftigungseffekte durch Automation und Rationalisierung möglich ist und welche Beschäftigtengruppen in einem solchen Fall davon betroffen sein können (s. 2.1.1). Der Fokus liegt dabei auf dem einzelnen Arbeitsplatz und auf verschiedenen Arbeitsplatztypen.
Technologischer Wandel kann darüber hinaus aber auch Geschäftsmodelle von Unternehmen auf den Prüfstand stellen, weil er zum Beispiel neuen Anbietern den Markteintritt ermöglicht und etablierte Unternehmen zum Marktaustritt zwingen könnte, wenn diesen die erfolgreiche Anpassung nicht gelingt. Davon können letztlich ganze Branchen betroffen sein. Darüber hinaus könnten über gesamtwirtschaftliche Kreislaufeffekte nachgelagerte Beschäftigungsimpulse ausgelöst werden, die die gesamtwirtschaftliche Beschäftigungsbilanz der Digitalisierung verbessern oder verschlechtern. In einem zweiten Schritt werden daher ausgewählte empirische Befunde vorgestellt, die die Betroffenheit von Branchen und der gesamten Volkswirtschaft in den Blick nehmen (s. 2.1.2).
Technologischer Wandel stellt nicht zwangsläufig die Beschäftigungsperspektiven auf den Prüfstand. Negative Beschäftigungseffekte werden unwahrscheinlicher, wenn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Lage sind, sich an die Veränderungen anzupassen. Dazu müssen sie die Kompetenzen aufweisen, aufbauen oder weiterentwickeln, die erforderlich sind, um die Arbeitsaufgaben in dem veränderten Umfeld adäquat erfüllen zu können. In einem dritten Schritt wird daher auf Basis ausgewählter empirischer Evidenz geprüft, welche Kompetenzen im digitalen Wandel an Bedeutung gewinnen könnten (s. 2.1.3)
2.1.1 Automatisierung und Rationalisierung
Die Diskussion um die Automationswirkungen und Rationalisierungseffekte durch Industrie 4.0 als Teilvariante des digitalen Wandels muss vor dem Hintergrund gesehen werden, dass in den letzten Jahren die Anzahl der im Einsatz befindlichen multi-funktionalen Industrieroboter in der vergangenen Dekade massiv angestiegen ist. Weltweit stieg die Anzahl der Industrieroboter zwischen 2007 und 2012 um 24 Prozent, in den nächsten beiden Folgejahren um rund weitere 20 Prozent (s. Tabelle 2-1). Bis 2018 wird mit einem massiven Anstieg auf über 2,3 Millionen Einheiten gerechnet. Dies wäre mehr als eine Verdopplung in einer guten Dekade. Auch wenn die Dynamik in Deutschland zwischen 2007 und 2014 schwächer verlaufen ist und bis 2018 als schwächer eingeschätzt wird, wird erwartet, dass sich der Bestand der Industrieroboter um rund die Hälfte vergrößert. Deutschland bleibt damit neben Nordamerika und den asiatischen Ländern China, Südkorea und Japan einer der Hauptanwender von multifunktionaler Robotertechnik.
Eine empirische Untersuchung signalisiert, dass sich die Nutzung von Industrierobotern in Deutschland anders als in anderen Ländern auf eine relativ geringe Anzahl von Industrieunternehmen konzentriert (Jäger et al., 2015, 36 ff.). So ist der Anteil der Unternehmen, die überhaupt Industrieroboter einsetzen relativ klein und auch der Anteil der Unternehmen, die Industrieroboter intensiv einsetzen, bleibt im Vergleich zu anderen Ländern zurück. Ob Roboter hierzulande oder in anderen Ländern zum Einsatz kommen, steht in einem signifikanten Zusammenhang mit der Größe eines Unternehmens und dem Umfang der Losgrößen in der Produktion und ist vor allem bei einer mittleren Produktkomplexität zu beobachten (Jäger et al., 2015, 79).
Eine steigende Verbreitung von multi-funktionalen Industrierobotern oder vergleichbarer Technologien impliziert, dass das Automatisierungs- und Rationalisierungspotenzial in einer Volkswirtschaft wächst und damit auch die Anzahl der negativ betroffenen Beschäftigten. Dabei stellt sich zudem die Frage, welche Beschäftigten davon betroffen sein könnten.
Frey und Osborne (2013) kommen für die USA zu dem Schluss, dass 47 Prozent aller heutigen Arbeitsplätze in den nächsten Jahrzehnten durch die Digitalisierung bedroht sein könnten. Dabei schätzen sie, ausgehend von einer Expertenbefragung, das Automatisierungspotenzial für 702 Berufe. Besonders gefährdet sind nach Ansicht der Autoren Beschäftigte im Bereich Transport und Logistik. Demnach könnten schon mittelfristig selbst fahrende Autos oder Drohnen einen Großteil der Warenauslieferung oder Postzustellung übernehmen. Aber auch Bürohilfskräfte und selbst ein Großteil der Beschäftigten im Dienstleistungsbereich zählen laut Frey und Osborne zu jenen Beschäftigten, die sich gut durch Roboter ersetzen ließen. In anderen Studien sind die Befunde bzw. die Methodik auf Deutschland übertragen worden. Bonin et al. (2015, 10) kommen zu dem Ergebnis, dass hierzulande 42 Prozent der Arbeitsplätze aufgrund der Zugehörigkeit zu bestimmten Berufen einem hohen Automatisierungsrisiko unterliegen. Die ingDiba (2015) ermittelt sogar einen Anteil von 59 Prozent gefährdeter Jobs.
Bonin et al. (2015, 11 ff.) weisen aber zugleich auf ein strukturelles Problem einer einfachen Übertragung des berufsorientierten Ansatzes von Frey und Osborne hin. Das Tätigkeitsprofil der Personen innerhalb der Berufsgruppe kann sich unterscheiden und ist auch nicht konstant. Ein berufsorientierter Ansatz läuft damit Gefahr, aufgrund der Annahme eines homogen Tätigkeitsprofils innerhalb einer Berufskategorie und heterogener Tätigkeitsprofile zwischen Berufsgruppen, die Automatisierungswahrscheinlichkeit für einen Beruf fehl einzuschätzen. Bonin et al. (2015) übernehmen daher lediglich die Automatisierungswahrscheinlichkeit von Tätigkeiten. Da Beschäftigte in Berufen, die nach Frey und Osborne einem hohen Automatisierungsrisiko unterliegen (>70 Prozent), ebenfalls auch nur bedingt automatisierbare Aufgaben wahrnehmen, sinkt der Anteil der Arbeitsplätze mit hoher Automatisierungswahrscheinlichkeit in Deutschland auf 12 Prozent. In den USA sind es nur noch 9 Prozent. Unabhängig davon, dass das Ausmaß der potenziellen Betroffenheit bei einem tätigkeitsorientierten Ansatz deutlicher geringer ist, zeigt sich ein bekanntes Bild, dass Arbeitsplätze von Geringqualifizierten einer deutlichen größeren Automatisierungswahrscheinlichkeit unterliegen (Bonin et al., 2015, 16).
Einen ähnlichen Ansatz wählen Dengler und Matthes (2015). Auch sie betrachten das Substituierbarkeitspotenzial von Tätigkeiten, wobei ebenfalls Routinetätigkeiten als potenziell automatisierbar gelten. Dieses Substituierbarkeitspotenzial wird durch den Anteil der Routineanforderungen an den Kernanforderungen eines einzelnen Berufs approximiert. Die einzelnen Berufe werden zu Berufshauptgruppen aggregiert und nach dem Anforderungsniveau differenziert, sodass die Beschäftigten innerhalb eines Berufssegments den Gruppen Helfer, Fachkraft, Spezialist oder Experte zugeordnet werden können.
Tabelle 2-2 zeigt, dass bei den Helfern und Fachkräften die Anzahl der Berufshauptgruppen mit einem großen Anteil von Anforderungen, die von Computern oder computergesteuerten Maschinen übernommen werden können (d. h. > 70 Prozent = hohes Substituierbarkeitspotenzial), vergleichbar hoch ist (auch wenn der Anteil der betroffenen Berufshauptgruppen bei Helfer größer ist). Die Spannbreiten des Substituierbarkeitspotenzials der jeweils betroffenen Berufshauptgruppen in den beiden Anforderungsniveaus fallen gleich groß aus. Bei ausgewählten betroffenen Berufshauptgruppen ist auch das Substituierbarkeitspotenzial bei beiden Anforderungsniveaus identisch. Dies trifft zum Beispiel auf Berufe in der Kunststoff- und Holzerstellung und -verarbeitung (Helfer: 73,0 Prozent, Fachkraft: 73,2 Prozent), in der Metallerzeugung und -bearbeitung sowie dem Metallbau (Helfer: 77,4 Prozent, Fachkraft: 77,4 Prozent) oder bei den Mathematik-, Biologie-, Chemie- und Physikberufen (Helfer: 83,3 Prozent, Fachkraft: 85,6 Prozent) zu (Dengler/Matthes, 2015, 27 ff.). Im Durchschnitt weisen Helfer und Fachkräfte mit etwa 45 Prozent ein gleich hohes Substitutionspotenzial auf, weil Tätigkeiten, die Letztere ausüben, zum Teil besser in programmierbare Algorithmen umgewandelt und dadurch leichter durch Computer ersetzt werden können (Dengler/Matthes, 2015, 12).
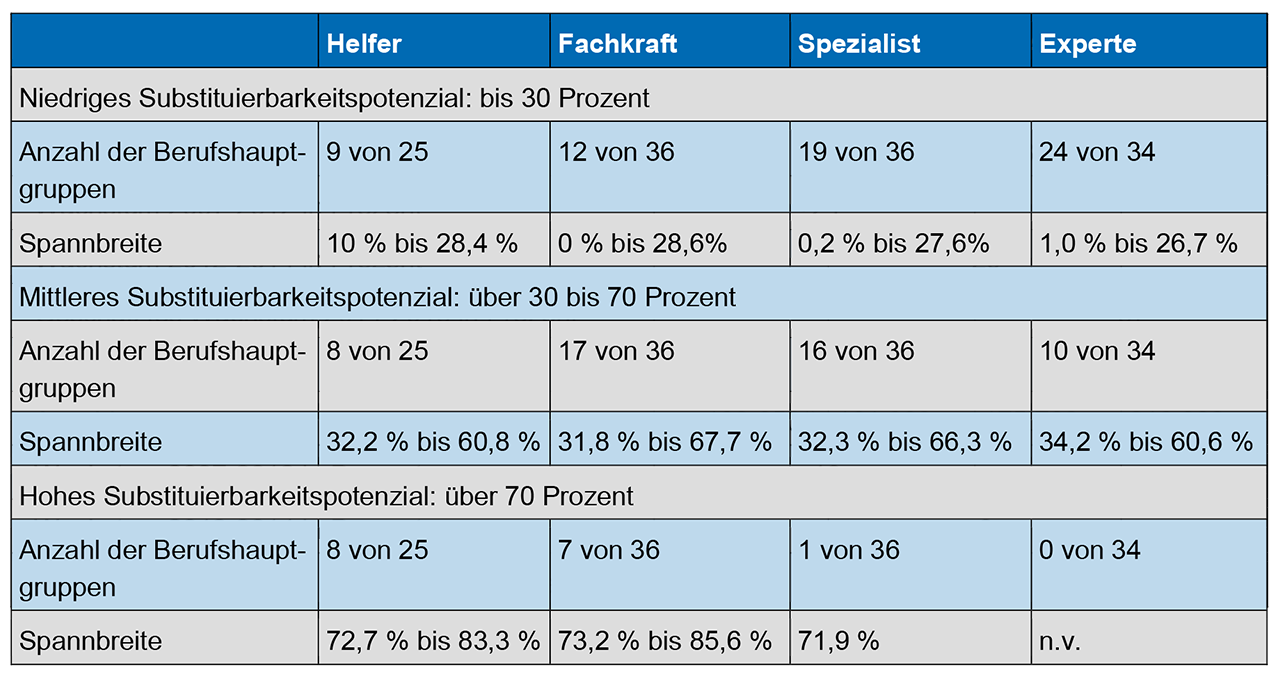 Object
Object
Es wird zudem deutlich, dass die Beschäftigten in Helfertätigkeiten keinesfalls immer einem hohen Risiko unterliegen, von Computern oder computergesteuerten Maschinen substituiert zu werden, sondern in relativ vielen Berufshauptgruppen (9 von 25) voraussichtlich nur in geringem Ausmaß betroffen sein könnten. Zugleich verdeutlicht Tabelle 2-2, dass auch unter den Spezialisten in einer Reihe von Berufen eine mittlere bis hohe Anzahl potenziell substituierbarer Tätigkeiten zu beobachten sind. Dazu zählen relativ häufig vor allem Fertigungsberufe und fertigungstechnische Berufe (Dengler/Matthes, 2015, 16). Berücksichtigt man die Anzahl der Beschäftigten in den verschiedenen Berufshauptgruppen arbeiten etwa 15 Prozent der Beschäftigten in Berufen mit einem hohen Substituierbarkeitspotenzial über 70 Prozent (Dengler/Matthes, 2015, 21). Die Untersuchung bestätigt damit die Befunde der Studie von Bonin et al. (2015).
Nun darf ein hohes Substituierbarkeitspotenzial oder Automatisierungsrisiko nicht verwechselt werden mit dem Umstand, dass die Arbeitsplätze auch tatsächlich wegfallen (müssen). So verweisen bereits Bonin et al. (2015, 18 f.) darauf, dass technische Automatisierungspotenziale überschätzt werden könnten, wenn eine Tätigkeit implizites Wissen oder Intuition voraussetzt oder rechtliche, gesellschaftliche oder ethische Hürden der Umsetzung einer neuen Technologie im Wege stehen. Ferner muss beachtet werden, dass die Implementierung neuer Technologien mit hohen Investitionskosten verbunden sein kann. Die Investitionen müssen sich daher rechnen, was voraussetzt, dass das technologische Automatisierungs- oder Rationalisierungspotenzial auch ökonomisch erforderlich ist. Offen ist, ob und wie sich die relativen Faktorpreise von Kapital und Arbeit verändern könnten.
Zumindest in kurzer Frist ist kein eindeutiger Zusammenhang zwischen Beschäftigungsentwicklung und Substituierbarkeitspotenzial zu erkennen (s. Tabelle 2-3). Die Korrelationskoeffizienten weisen nur bei Fachkräften, Spezialisten und Experten das zu erwartende negative Vorzeichen auf. Ein negatives Vorzeichen bedeutet, dass die Beschäftigungsentwicklung in einer Berufshauptgruppe tendenziell zurückhaltender verläuft, wenn sie ein relativ hohes Automatisierungspotenzial aufweist. Eine signifikante Korrelation ist auch nur in einer Konstellation zu beobachten, nämlich bei den Fachkräften für den Zeitraum 30. Juni 2014 bis 30. Juni 2015. Dabei ist zu beachten, dass die Beschäftigungsentwicklung in allen Berufshauptgruppen auf allen Anforderungsniveaus positiv verlaufen ist oder zumindest stabil geblieben ist.
Zurück zur Übersicht
Tabelle 2-3: Beschäftigungsentwicklung und Substituierbarkeitspotenzial
Korrelationskoeffizienten nach Pearson
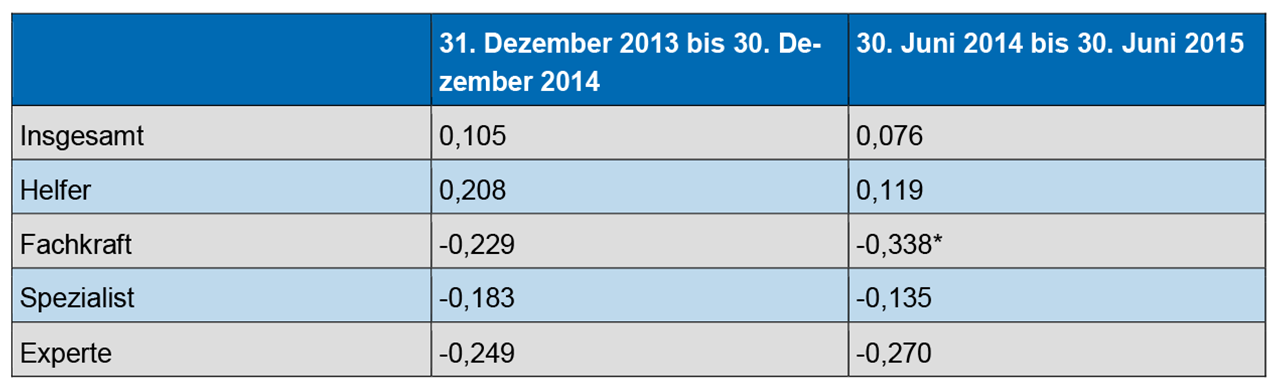 Ausgeübte Tätigkeit nach der KldB 2010. *: Zweiseitige Signifikanz auf 5-Prozentniveau.
Ausgeübte Tätigkeit nach der KldB 2010. *: Zweiseitige Signifikanz auf 5-Prozentniveau.
Eine Analyse auf Basis der Berufsklassifikation KldB2010 ist nur für die jüngste Vergangenheit möglich. Der Zeitraum zur Analyse von potenziellen Beschäftigungswirkungen der Automatisierung unter Berücksichtigung der heute geschätzten Substitutionsmöglichkeiten ist folglich sehr kurz. Die Befunde könnten daher unter dem Vorbehalt stehen, dass sich in längerer Perspektive bereits unterschiedliche Entwicklungslinien aufgezeigt hätten. Allerdings signalisieren auch andere empirische Untersuchungen, dass sich aus Automatisierung oder Digitalisierung keinesfalls zwangsläufig negative Beschäftigungsentwicklungen ergeben müssen:
- Jäger et al. (2015, 83) finden in ihrer empirischen Untersuchung, die Betriebe in insgesamt sieben Ländern erfasst, zwar eine signifikant positive Korrelation zwischen Umfang des Robotereinsatzes und der Arbeitsproduktivität, aber keinen statistisch abgesicherten Effekt auf die totale Faktorproduktivität. Ein Rationalisierungsszenario wäre denkbar, weil eine gegebene Outputmenge mit einem geringeren Arbeitseinsatz herstellbar wäre. Allerdings signalisieren vertiefende ökonometrische Analysen keinen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen dem Umfang des Robotereinsatzes in einem Betrieb und einer Veränderung der Belegschaftsgröße.
- Graetz und Michaels (2015) zeigen für die Volkswirtschaft als Ganzes, dass sich die zunehmende Nutzung von Robotern in 17 Ländern und verschiedenen Industriezweigen zwischen 1993 und 2007 positiv auf die Arbeitsproduktivität und das Wirtschaftswachstum ausgewirkt hat. So erhöhte der Einsatz von Robotertechnik zum Beispiel das BIP-Wachstum im Schnitt um 0,37 Prozentpunkte. Die Gesamtzahl der Arbeitsstunden war hingegen durch den stärkeren Robotereinsatz nicht betroffen, was gegen die Befürchtung eines gesamtwirtschaftlichen Beschäftigungsrückgangs im Zuge des arbeitssparenden technischen Fortschritts spricht.
- Kromann et al. (2011) zeigen für sieben Länder auf Branchenebene, dass sowohl in kurzer wie in langfristiger Perspektive die Arbeitsproduktivität durch einen höheren Einsatz von Industrierobotern steigt. Die Beschäftigung sinkt im Zusammenhang mit dem Einsatz von Robotern in kurzer Frist tendenziell (allerdings nur signifikant auf 10-Prozentniveau und nicht robust) und wächst in langer Frist eher (allerdings nicht signifikant). Dies könnte man als schwache empirische Evidenz dafür interpretieren, dass der arbeitssparende technische Fortschritt bei konstantem Output und Kapitalstock unter bestimmen Voraussetzungen (z. B. geringe Substitutionselastizität zwischen Arbeit und Kapital) mit Beschäftigungseinbußen einhergeht (kurze Frist), aber auf lange Sicht aufgrund der geringeren Grenzkosten der Produktion zu einem Anstieg im Output und einem größeren Kapitalstock führen kann. Die empirische Analyse signalisiert zudem, dass in langfristiger Perspektive der statistische Zusammenhang zwischen dem Einsatz von Industrierobotern (Automatisierung) und der Arbeitsproduktivität bzw. der Beschäftigung unabhängig ist vom komplementären Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien.
- Hammermann und Stettes (2015a) wählen einen anderen Ansatz und klassifizieren die Unternehmen nach dem Grad der Befassung mit dem Thema Digitalisierung und der Bedeutung des Internets für die geschäftlichen Aktivitäten. Ihr Ansatz geht folglich über den Fokus Einsatz von Industrierobotern hinaus. Sie unterscheiden dabei zwischen Unternehmen, die sich bereits durch einen hohen Grad der Digitalisierung auszeichnen, und solchen, bei denen das Thema Digitalisierung bislang noch nicht so weit oben auf der Agenda gestanden hat. Ein zentrales Merkmal hoch digitalisierter Unternehmen ist ein relativ großer Anteil von Beschäftigten an Arbeitsplätzen mit Internetzugang. Auch in dieser Untersuchung findet sich kein Hinweis für eine negative Beschäftigungswirkung im Zusammenhang mit dem Digitalisierungsprozess. Insgesamt verzeichnete jeweils die Hälfte der befragten Unternehmen in beiden Gruppen in den letzten zwei Jahren einen Beschäftigungsaufbau. Auch mit Blick auf die Beschäftigungsentwicklung in der mittleren Frist (bis zu fünf Jahre) sind keine signifikanten Unterschiede zwischen stark digitalisierten und weniger digitalisierten Betrieben zu erkennen. Dies gilt für alle Qualifikationsniveaus.
Zusammengefasst besteht derzeit noch eine große Unsicherheit über das Ausmaß der potenziellen Beschäftigungseffekte, die im Zusammenhang mit der Einführung digitaler Technologien und Automatisierungstechnologien entstehen könnten, und der Betroffenheit bestimmter Beschäftigtengruppen. Erschwerend kommt hinzu, dass ein technologiegetriebener Beschäftigungsimpuls mit unterschiedlichen Beschäftigungswirkungen in der kurzen und langen Frist zudem überlagert werden kann von gesamtwirtschaftlichen Anpassungsprozessen (Bonin et al., 2015, 20 f.) oder von branchenbezogenen Umwälzungen, wenn komplette Geschäftsmodelle auf den Prüfstand geraten.
Zusammengefasst besteht derzeit noch eine große Unsicherheit Über das Ausmaß der potenziellen Beschäftigungseffekte, die im Zusammenhang mit der EinfÜhrung digitaler Technologien und Automatisierungstechnologien entstehen könnten, und der Betroffenheit bestimmter Beschäftigtengruppen. Erschwerend kommt hinzu, dass ein technologiegetriebener Beschäftigungsimpuls mit unterschiedlichen Beschäftigungswirkungen in der kurzen und langen Frist zudem Überlagert werden kann von gesamtwirtschaftlichen Anpassungsprozessen (Bonin et al., 2015, 20 f.) oder von branchenbezogenen Umwälzungen, wenn komplette Geschäftsmodelle auf den PrÜfstand geraten.
2.1.2 Sektoraler und gesamtwirtschaftlicher Wandel
Knapp zwei Drittel der hiesigen Unternehmen gehen Auswertungen des IW-Personalpanels 2014 zufolge davon aus, dass sie ihre Anpassungsfähigkeit an sich verändernde Marktbedingungen erhöhen müssen, um von einer zunehmenden Verbreitung des Internets in den kommenden Jahren profitieren zu können. Unter den hoch digitalisierten Unternehmen sind es mit drei Viertel deutlich mehr als unter den weniger digitalisierten mit gut der Hälfte (IW Köln, 2015, 126). Marktbedingungen verändern sich insbesondere durch den Eintritt neuer Wettbewerber oder den Rückgang oder das Wachstum von Marktanteilen von etablierten Marktteilnehmern, wodurch Konzentrationsprozesse ausgelöst oder beschleunigt werden und sich damit neue Marktmachtstrukturen etablieren. Dann geraten weniger Berufe oder einzelne berufliche Tätigkeiten auf den Prüfstand, sondern vielmehr Unternehmen, ihre Geschäftsmodelle und die damit verbundenen Arbeitsplätze. Besonders markant werden die Veränderungen dort wahrgenommen, wo sich das Konsumverhalten des Einzelnen durch den Zugriff auf orts- und zeitungebundene Dienste und den Zugang zu Netzwerken verändert. Gerade der Bankensektor, die Medienwirtschaft, der Transportsektor und der Handel gelten neben dem Gesundheitssektor und der Energiewirtschaft als die Bereiche, in denen etablierte Geschäftsmodelle durch die digitale Wirtschaft auf den Prüfstand geraten (OECD, 2015, 54 f. und 148 ff.).
Auswertungen des IW-Personalpanels signalisieren, dass der Digitalisierungsgrad – gemessen an der Befassung mit dem Thema Digitalisierung und der Bedeutung des Internets für die Geschäftsaktivitäten – in den unternehmensnahen Dienstleistungsbranchen höher ist als in der Industrie (IW Köln, 2015, 114 ff.). Darunter fallen die Wirtschaftszweige Banken/Versicherungen, Verkehr/Logistik, Großhandel, Medien/Informationswirtschaft sowie Wirtschaftsnahe Dienste. Der Befund eines relativ hohen Digitalisierungsgrads von Unternehmen in den unternehmensnahen Dienstleistungen korrespondiert im Großen und Ganzen mit einem Digitalisierungsgrad, der auf Basis der Patentanmeldungen mit Digitalisierungstechnologien in Relation zu allen Patentanmeldungen in einem Wirtschaftszweig und der Bedeutung der Vorleistungen aus digitalisierten Wirtschaftszweigen gemessen wird. Demzufolge waren die Wirtschaftsbereiche Audiovisuelle Medien und Rundfunk (Digitalisierungsgrad: 58,2 Prozent), Erbringung von Finanzdienstleistungen (47,3 Prozent), Werbung und Marktforschung (51,4 Prozent, Telekommunikation (52,4 Prozent), Rechts- und Steuerberatung/Unternehmensberatung (47,1 Prozent) und IT- und Informationsdienstleister (47,5 Prozent) im Jahr 2012 vergleichsweise stark digitalisiert (PROGNOS, 2015, 19 und 46). Ein ähnliches Bild ergibt sich auch bei der Betrachtung eines Digitalisierungsgrades, der unter anderem die Vertriebsaktivitäten über das Internet, die Anteile der Beschäftigten, die am Computer und an einem Internetarbeitsplatz tätig sind, und die Art des Internetzuganges berücksichtigt. Auch bei dieser Betrachtungsweise ist eine relativ starke Durchdringung des Telekommunikationssektors, des Bereichs Verlagswesen/ audiovisuelle Medien/Rundfunk, der IT- und Informationsdienstleister sowie der Finanz- und Versicherungsdienstleister zu erkennen (BMWi, 2014, 14).
Der Blick in die Beschäftigtenstatistik signalisiert allerdings, dass die Entwicklung in den entsprechenden Wirtschaftszweigen zwischen 2008 und 2015 höchst unterschiedlich verlaufen ist (s. Tabelle 2-4). Diese Heterogenität ist selbst innerhalb der Wirtschaftsbereiche zu beobachten, wenn man die Wirtschaftszweigklassen 59 und 60, 62 und 63 sowie 69 und 70 miteinander vergleicht. Offen ist dabei, ob der Beschäftigungsabbau bzw. der -aufbau im Zusammenhang mit der zunehmenden Digitalisierung und sich verändernden Geschäftsmodellen gestanden hat. Wenn aber bereits Vergangenheitswerte kaum einen eindeutigen Schluss zulassen, wie sich durch die Digitalisierung verändernde Wettbewerbsbedingungen für etablierte Unternehmen und potenzielle Wettbewerber auf die Beschäftigung in einer Branche niederschlagen, unterliegen sämtliche Prognosen einer hohen Unsicherheit.
Hinzu kommt schließlich noch ein weiterer Aspekt. Selbst wenn einzelne Branchen eindeutig positiv oder negativ von der Digitalisierung betroffen sein sollten, bedeutet dies gleichfalls noch nicht, dass sich aus den erwarteten oder bereits zu beobachtenden Veränderungen automatisch gleichgerichtete Entwicklungen auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene ergeben müssen. Hierzu bedarf es gesamtwirtschaftlicher Analysen.
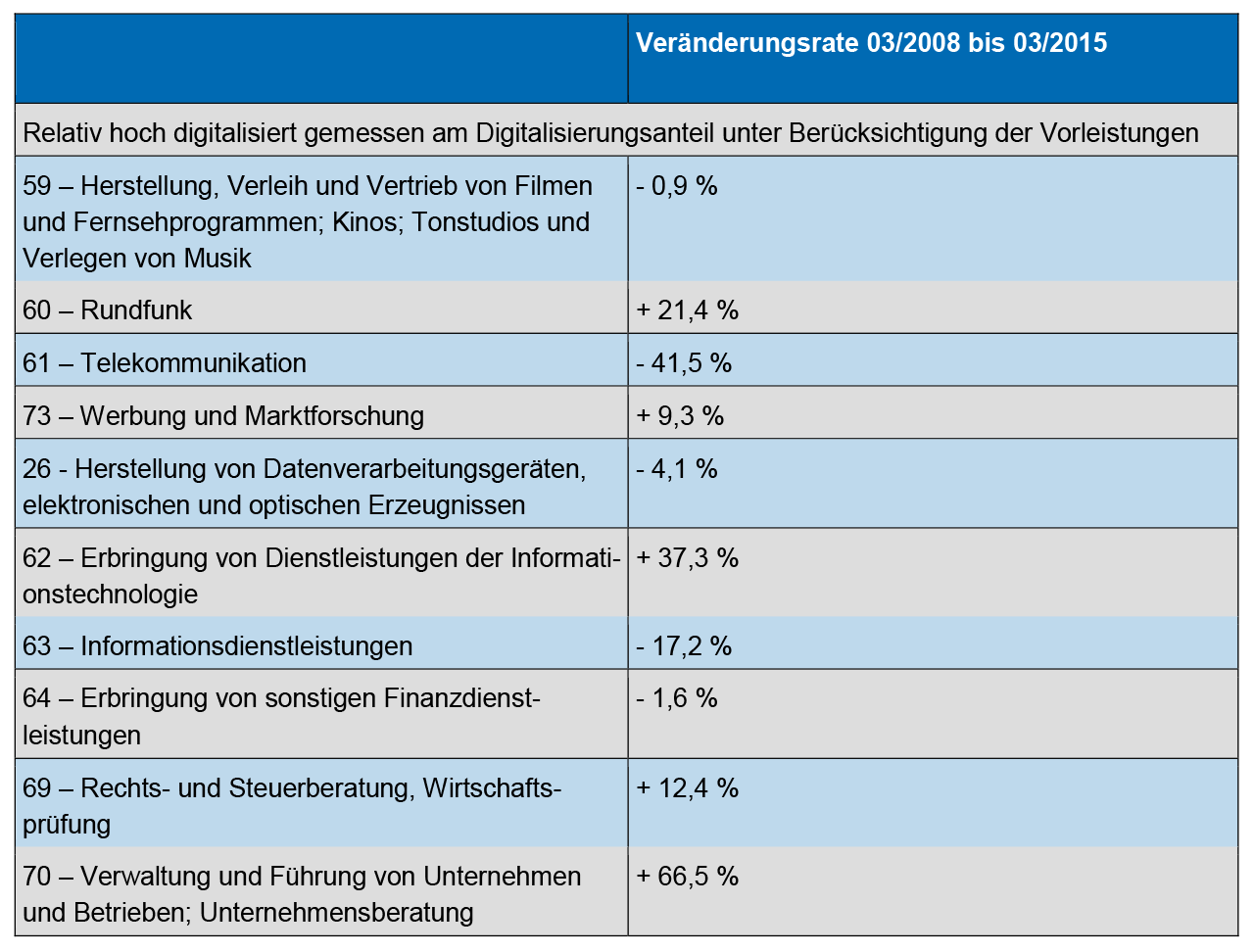 Ziffer: Wirtschaftszweigklassen nach WZ2008.
Ziffer: Wirtschaftszweigklassen nach WZ2008.
Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat ein Szenario über die potenziellen Beschäftigungsveränderungen in Berufshauptfeldern und der Gesamtwirtschaft erstellt, dass sich im Zusammenhang mit der Verbreitung von Industrie 4.0 aufgrund gesamtwirtschaftlicher Kreislaufeffekte ergeben könnte (Wolter et al., 2015). Dabei stehen Veränderungen der Wirtschaftsstruktur und der Struktur der Investitionstätigkeiten im Vordergrund. Die Autoren gehen dabei von folgenden Annahmen aus:
7. Ausrüstungsinvestitionen: Eine zunehmende Verbreitung des Konzepts Industrie 4.0 geht mit einem Anstieg der Ausrüstungsinvestitionen einher, die erforderlich werden, da der vorhandene (alte) Kapitalstock umgerüstet und nach und nach ersetzt werden muss (neue Ausrüstungsinvestitionen). Entsprechend profitieren die Branchen in unterschiedlichem Umfang von diesem Investitionszyklus.
8. Bauinvestitionen: Es wird mit einem temporären Anstieg der Bauinvestitionen gerechnet, um die erforderliche digitale Infrastruktur auszubauen (z. B. Breitbandtechnologien). Gerade für digital ausgerichtete Betriebe ist ein schnellerer Zugang zum Internet eine zentrale Voraussetzung dafür, dass sie von der zunehmenden Verbreitung des Internets auch profitieren können (IW Köln, 2015, 126).
9. Ressourcenaufwand: Die Autoren gehen davon aus, dass die Betriebe zusätzlich Investitionen in die Weiterbildung, in Beratungs- und IT-Dienstleistungen tätigen werden, um die Potenziale von Industrie 4.0 ausschöpfen zu können. Dies ermöglicht es ihnen, den Ressourceneinsatz zu reduzieren.
Für die einzelnen Branchen und Berufshauptfelder werden Beschäftigungseffekte ermittelt, die sich aus den Teilszenarien, die hinter den Annahmen 1. bis 3. stehen, ergeben. Ausschlaggebend für die Arbeitsmarktwirkung sind die Betroffenheit der Branchen sowie die Verteilung der einzelnen Berufsfelder auf die verschiedenen Branchen bzw. deren Beschäftigungsanteil innerhalb einer Branche. Die drei Teilszenarien werden durch ein viertes Teilszenario ergänzt, bei dem die Autoren auf die Überlegungen von Dengler und Matthes (2015) zurückgreifen, dass die Rationalisierungswahrscheinlichkeit vom Umfang der Routinetätigkeiten abhängt.
10. Automation: Die Substituierbarkeit von Tätigkeiten durch Computertechnologien führt zu einer Veränderung der Berufsfeldstruktur in einer Branche. Der Beschäftigungseffekt ist vor diesem Hintergrund umso günstiger, je größer der Anteil der Nicht-Routine-Tätigkeiten in einem Berufsfeld und je größer der Anteil der Beschäftigten dieses Berufsfeldes in einer Branche ist. Im Umkehrschluss gilt das Gegenteil für das Gewicht von Routinetätigkeiten.
Die Autoren ermitteln Schritt für Schritt (ausgehend vom Teilszenario 1. bis zum Teilszenario 4.) die denkbaren Beschäftigungsveränderungen in den verschiedenen Berufshauptfeldern. Tabelle 2-5 fasst die Szenarien qualitativ zusammen. Wolter et al. (2015) zufolge müssen Beschäftigte in be- und verarbeitenden bzw. instandsetzenden Berufen, wie zum Beispiel Hilfskräfte und Hausmeister, Metall- und Anlagenbauer, und in Maschinen und Anlagen steuernden Berufen kurz- und langfristig mit einer deutlichen Eintrübung ihrer Beschäftigungsperspektiven rechnen (rot gefettet). Für Personen, die IT- und naturwissenschaftliche Berufe ausüben, gehen die Autoren ebenso von einem starken Beschäftigungswachstum aus wie für solche, die Rechts-, Management- oder wirtschaftswissenschaftliche Berufe ausüben (rot gefettet).
Mit Blick auf die Beschäftigung in der gesamten Volkswirtschaft ergibt die Szenariorechnung in kurzer Frist bis zum Jahr 2020 einen Beschäftigungseffekt im Saldo von minus 40.000 Beschäftigungsverhältnissen, in langer Frist bis zum Jahr 2030 von minus 100.000 (Wolter et al., 2015, 47), wenn die erweiterten Berufshauptfelder aus Tabelle 2-5 in den Blick genommen werden. Die Autoren gehen unter den Annahmen ihrer Szenariorechnung davon aus, dass bis zum Jahr 2030 rund 150.000 Arbeitsverhältnisse für Beschäftigte mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung verloren gehen.
Die vorgestellten Szenarien sind allerdings mit Vorsicht zu betrachten. Zunächst einmal hängen die quantitativen Beschäftigungswirkungen entscheidend davon ab, wie die Annahmen in den Modellberechnungen für die einzelnen Teilszenarien zahlentechnisch erfasst werden. So gehen Wolter et al. (2015, 27) davon aus, dass bis zum Jahr 2025 jährlich Aus- und Umrüstungsinvestitionen im Volumen von durchschnittlich 1,5 Milliarden Euro getätigt werden. Geringere Investitionsaktivitäten wären dann mit entsprechend schwächeren Beschäftigungsimpulsen verbunden. Darüber hinaus ist offen, ob sich die Szenarien auch bei Veränderungen der relativen Entlohnungen zwischen Beschäftigtengruppen und zwischen den Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital ergeben würden. Kurzfristig mag zwar von deren Konstanz ausgegangen werden. Langfristig ist aber zu erwarten, dass kurzfristig eintretende potenzielle Beschäftigungsveränderungen zu einer Anpassung der Lohnrelationen bzw. Lohn-/Zinsrelationen führen werden.
2.1.3 Arbeitsanforderungen in der digitalisierten Wirtschaft
Auch wenn die Prognosen, wie sich die Beschäftigung in Zukunft zahlenmäßig insgesamt und in bestimmten Berufen oder Branchen entwickeln wird, mit Vorsicht zu betrachten sind, signalisieren die ihnen zugrundeliegenden Einschätzungen gleichwohl, dass sich die Arbeit der einzelnen Beschäftigten verändern kann. Dies impliziert, dass sie sich auf variable und für sie neue berufliche Anforderungen einstellen sollten, und zwar unabhängig davon, ob Veränderungen durch neue bzw. modifizierte Geschäftsmodelle oder technologische Neuerungen an ihrem Arbeitsplatz ausgelöst werden. Die breite Mehrheit der hiesigen Unternehmen ist davon überzeugt, dass eine höhere Veränderungsbereitschaft bei Mitarbeitern und Führungskräften erforderlich ist, um von einer größeren Verbreitung des Internets auch profitieren zu können (IW Köln, 2015, 126). Die Frage ist, bei welchen beruflichen Anforderungen und in welchen Kompetenzbereichen Veränderungsbedarf auf gesamtwirtschaftlicher Ebene existiert.
Es liegt zunächst die Vermutung nahe, dass in einer digitalisierten Arbeitswelt und Wirtschaft ein großer Bedarf an Personen existieren wird, die in der Lage sind, digitale Technologien und die dazugehörigen Programme zu entwickeln. In der Tat ist mit der zunehmenden Verbreitung von Informations- und Kommunikationstechnologien auch der Anteil der IKT-Spezialisten in fast allen OECD-Ländern in den letzten Jahren angestiegen – in Deutschland von 2,9 auf 3,5 Prozent zwischen 2011 und 2014 (s. Abbildung 2-1). Einer Analyse von empirica auf Basis der europäischen Arbeitskräfteerhebung zur Folge können mehr als zwei Drittel (835.000 von insgesamt 1.206.000) der klassischen IKT-Fachkräfte in Deutschland als hochqualifiziert gelten und gehören den Gruppen Service-Manager/Analysten und Entwickler/Programmierer/System-administratoren an (Hüsing et al., 2015, 8 und 31).
Wenn eine digitalisierte Wirtschaft auf Informations- und Kommunikationstechnologien sowie dem Internet aufbaut, werden Kompetenzen, wie man adäquat mit diesen Technologien umgeht, zu einem entscheidender Faktor für die effektive und effiziente Nutzung von digitalen Produkten und Diensten (OECD, 2012, 7; IWConsult/BITKOM, 2013, 20 f.). Bereits heute arbeiten im Mittel knapp sechs von zehn Beschäftigten hierzulande an einem Arbeitsplatz mit einem Internetzugang, in den stark digitalisierten Betrieben sind es sogar drei von vier (s. Tabelle 2-6). Die Zahl der Beschäftigten, die zumindest gelegentlich mit einem Computer (mit oder ohne Internetzugang) arbeiten, liegt mit mehr als acht von zehn noch darüber (Gehrke et al., 2014, 41). Dabei verbringen sie im Durchschnitt knapp die Hälfte ihrer Arbeitszeit mit Tätigkeiten am Computer. Für die Mehrzahl dieser Beschäftigten (rund 53 Prozent) sind IKT-Grundkenntnisse ausreichend und bei rund 86 Prozent beschränkt sich die Nutzung des Computers auf die reine Anwendung (Gehrke et al., 2014, 43f.). Lediglich bei Führungskräften in der Produktion und bei speziellen Dienstleistungen (20 Prozent) sowie erwartungsgemäß bei akademisch ausgebildeten Naturwissenschaftlern, Mathematikern und Ingenieuren (23 Prozent) liegen die Anteilswerte der Personen, die in ihrer Arbeit den Computer über reine Anwendungskenntnisse hinaus nutzen, deutlich darüber.
Fähigkeiten, die zur Entwicklung von digitalen Technologien und deren unmittelbaren Anwendung im beruflichen Kontext benötigt werden, sind das Eine. Wenn jedoch die Digitalisierung Geschäftsmodelle und die Organisation, wie wir arbeiten, verändern wird, ist auch die Kompetenz gefragt, dieses Potenzial zu erkennen und am besten für das eigene Unternehmen nutzbar zu machen. In diesem Zusammenhang spricht man von IT-Leadership-Kompetenzen (IWCon-sult/BITKOM, 2013, 21) bzw. e-Leadership-Kompetenzen (Hüsing et al., 2013, 67 ff.). Sie verhelfen Unternehmen, neue Einsatzmöglichkeiten von Informations- und Kommunikationstechnologien in der Leistungserstellung oder bei Innovationsprozessen zu finden, Grenzen der unter-schiedlichen internen IKT-Systeme und Synergiepotenziale zu erkennen sowie letztlich Spielräume für eine überbetriebliche Lösungsalternative mit IKT-Diensten zu identifizieren. Dies impliziert, dass zum Beispiel ein IKT-Spezialist zusätzlich über Führungskompetenzen verfügen sollte und dabei wirtschaftliche sowie organisatorische Aspekte des Wertschöpfungsprozesses im Auge haben sollte. Umgekehrt sollte zum Beispiel eine mit Führungsaufgaben betraute Person über ein ausreichendes Maß an IKT-Kompetenzen verfügen. Ferner sollten die IT- bzw. e-Leader ähnlich wie ein Entrepreneur auch das Gespür aufweisen, neue Möglichkeiten zu erkennen, und den Willen, diese zu erschließen. Zusammengenommen sollten sie folglich über die Expertise in einem bestimmten Fachgebiet verfügen, analytische und soziale Kompetenzen aufweisen, um eine Zusammenarbeit in unterschiedlichsten Kontexten zu ermöglichen, sowie ein Mindestmaß an IKT-bezogener Handlungskompetenz aufweisen (Hüsing et al., 2013, 78 f.).
Ob und in welchem Umfang dies auf Beschäftigte hierzulande oder andernorts zutrifft, ist nicht genau abzuschätzen, denn dazu fehlt eine eindeutige empirisch operationalisierte Definition der IT- bzw. e-Leadership-Kompetenz. Husing et al. (2013, 93 ff.) wagen den Versuch einer Schätzung, wobei sie mit Blick auf die Nachfrage nach IT- bzw. e-Leadership davon ausgehen, dass größere Unternehmen ebenso eine größere Anzahl benötigen wie Betriebe, deren Geschäfts- und Innovationsaktivitäten in starkem Maße technikgestützt ablaufen. Sie ermitteln für Europa einen Bedarf an 683.000 Personen. Ihre Schätzung des Angebots an IT- bzw. e-Leadern schätzen sie auf Basis von subjektiv vermuteten Quoten. So gehen sie davon aus, dass ein bestimmter Anteil der in den verschiedenen Managementberufen tätigen Beschäftigten über IT- bzw. e-Leadership-Kompetenzen verfügen.2 Auf dieser Basis ermitteln sie ein Angebot von 661.000 Personen. Mit einer zunehmenden Durchdringung der Arbeitswelt mit digitalen Technologien ist zu erwarten, dass sowohl die IKT-bezogenen Kompetenzen (Entwicklung und Anwendung) als auch andere berufsrelevante Kompetenzen (Leadership) für einen Großteil der Beschäftigten an Bedeutung gewinnen werden. Dabei ist zu beachten, dass Kompetenzen, die für IT- bzw. e-Leader relevant sind, auch für andere Beschäftigte wichtig sein sollten, weil diese in ihrer täglichen Arbeit als Entwickler oder Anwender am Ende über eine erfolgreiche Umsetzung von Veränderungsprozessen in den betrieblichen Alltag (mit-)entscheiden.
Darauf deuten auch die Befunde von Hammermann und Stettes (2016) auf Basis des IW-Personalpanels hin. Sie zeigen, dass bereits heute stark digitalisierte Unternehmen (Unternehmen 4.0) signifikant häufiger davon ausgehen als wenig digitalisierte Betriebe (Unternehmen 3.0), dass in den kommenden fünf Jahren für die Mehrheit der Beschäftigten IT-Fachwissen (64 Prozent vs. 43 Prozent) und die Kompetenz, mit dem Internet als berufliches Medium adäquat umgehen zu können (75 Prozent vs. 51 Prozent), an Bedeutung gewinnen werden (s. Tabelle 2-7). Ein ebenfalls signifikanter Unterschied findet sich ebenso mit Blick auf das berufliche bzw. betriebliche Erfahrungswissen (71 Prozent vs. 56 Prozent) wie für technisches (61 Prozent vs. 53 Prozent) und betriebswirtschaftliches Fachwissen (57 Prozent vs. 52 Prozent) sowie die Fähigkeit, adäquat mit Kollegen und Geschäftspartnern kommunizieren und kooperieren zu kön-nen (83 Prozent vs. 72 Prozent).
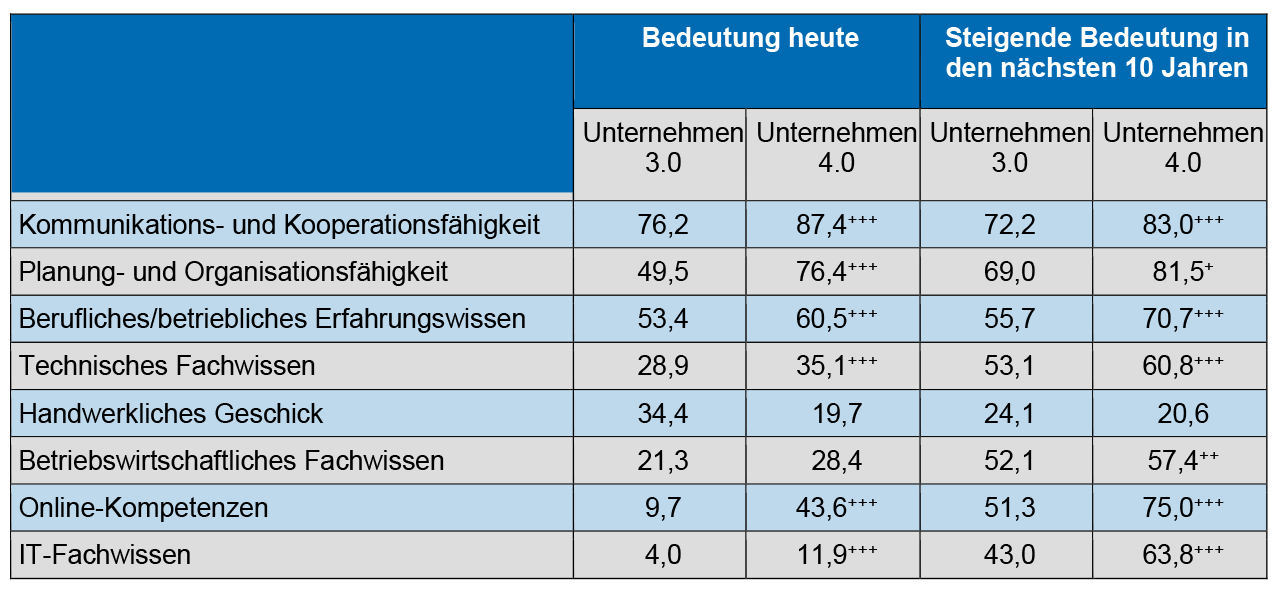
Ein vertiefter Blick zeigt zudem, dass der Bedeutungszuwachs eines Kompetenzbereichs auch davon abhängt, in welchem Funktionsbereich sich ein Unternehmen mit dem Thema Digitalisierung intensiv auseinandersetzt sowie für welchen Verwendungszweck es das Internet bereits heute einsetzt (s. Tabelle 2-8). So sagen 67 Prozent der Unternehmen, die das Thema Digitalisierung im Zusammenhang mit Beschaffungsprozessen bearbeiten, dass IT-Fachwissen für die Mehrheit der Beschäftigten bedeutsamer wird. Dies gilt gleichermaßen für sieben von zehn Betrieben mit Blick auf Online-Kompetenzen. Ein ähnlicher Befund findet sich auch für die meisten anderen Funktionsbereiche und heutigen Verwendungszwecke. Beide Kompetenzbereiche können daher als Schlüsselqualifikationen in einer digitalen Arbeitswelt angesehen werden.
Der Blick auf die anderen vier Kompetenzen, bei denen stark digitalisierte Betriebe von einer steigenden Bedeutung für die Mehrheit der Beschäftigten ausgehen, fällt uneinheitlich aus:
- Unternehmen gehen signifikant eher von einer wachsenden Bedeutung betriebswirtschaftlichen Fachwissens aus, wenn sie sich mit dem Thema Digitalisierung in Funktionsbereichen auseinandersetzen, in denen die kaufmännische Expertise zu den wichtigen Voraussetzungen für die erfolgreiche Verrichtung der dort anfallenden Aufgaben zählt. Diese Korrelationen waren zu erwarten gewesen. In welchen Bereichen das Internet heute bereits als Erfolgsfaktor für das Unternehmen zum Einsatz kommt, spielt dagegen eine eher untergeordnete Rolle. Es finden sich nur einzelne statistisch signifikante Korrelationen mit den heutigen Verwendungszwecken des Internets (Rekrutierung von Mitarbeitern über das Internet sowie die Gewinnung und Analyse von Daten).
- Es wäre zu vermuten gewesen, dass insbesondere Betriebe von einem höheren Gewicht des technischen Fachwissens in der Zukunft überzeugt sind, in denen das Thema Digitalisierung im Funktionsbereich Produktion erörtert wird und die das Internet bereits heute als Mittel einsetzen, um Maschinen zu vernetzen und zu steuern. Diese Hypothese bestätigt sich jedoch nicht. Im ersteren Fall ist die Korrelation nur auf dem 10-Prozent-Fehlerniveau signifikant, im letzteren ist überhaupt keine zu erkennen. Dieser überraschende Befund könnte darauf hindeuten, dass die betroffenen Unternehmen die Verbreitung technischen Fachwissens in ihrer Belegschaft als ausreichend erachten. Denn eine alternative Erklärung, wonach das Gros der Beschäftigten in anderen Bereichen des Unternehmens arbeitet, wo technisches Fachwissen keine besonders große Relevanz besitzt, erscheint vor dem Hintergrund der signifikanten Korrelationen bei den Funktionsbereichen Beschaffung, Logistik und Finanzen nicht plausibel.
- Für die Erwartung, dass berufliches und betriebliches Erfahrungswissen für die Mehrzahl der Belegschaftsangehörigen wichtiger wird, scheint die Frage, in welchen Funktionsbereichen sich mit dem Thema Digitalisierung auseinandergesetzt wird, nachrangig zu sein. Lediglich im Zusammenhang mit dem Einsatz des Internets, um Daten auszutauschen oder diese zu gewinnen und zu analysieren, wird ein Anstieg des Erfahrungswissens prognostiziert. Dies könnte darauf hindeuten, dass berufliches Erfahrungswissen Beschäftigte in die Lage versetzt, einschätzen zu können, welche Daten am besten mit externen Partnern ausgetauscht werden sollten und am besten über das Internet erfasst und analysiert werden können, um Transaktionskosten zu minimieren. Vereinfacht formuliert: wer weiß, wo er was sucht, findet auch eher das Richtige.
- In welchem konkreten Funktionsbereich sich ein Unternehmen mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzt, scheint keine eigenständige Rolle für die Erwartung zu spielen, dass es in der Zukunft für die Mehrzahl der Beschäftigten wichtiger wird, adäquat mit Kollegen und externen Partnern kommunizieren und zusammenarbeiten zu können. Dies könnte aber mit dem Umstand zusammenhängen, dass die breite Mehrheit der Betriebe von dem Bedeutungszuwachs dieser Schlüsselkompetenz überzeugt ist. Die entsprechenden Anteilswerte sind lediglich in einigen Einsatzbereichen des Internets zu beobachten. So ist denkbar, dass der online-Vertrieb eigener Produkte und Dienste noch einmal höhere Anforderungen an die Kommunikationsfähigkeit stellen als herkömmliche Vertriebswege, zum Beispiel, weil mehr Mitarbeiter unmittelbaren Kontakt zum Kunden erhalten. Für die signifikanten Korrelationen mit der Nutzung von Cloudservices und der Gewinnung und Auswertung von Daten findet sich keine überzeugende Hypothese.
Die Unternehmen sind sich der eigenen Handlungsfelder bewusst, damit sie von einer zunehmenden Verbreitung des Internets wirtschaftlich profitieren können. Dies gilt gleichermaßen für betriebliche Qualifizierungsmaßnahmen zur besseren beruflichen Nutzung des Internets – dies sagen sieben von zehn der stark digitalisierten Unternehmen – wie für den Erhalt und die Steigerung der Veränderungsbereitschaft der Mitarbeiter und Führungskräfte – dies sagen drei Viertel der stark digitalisierten Unternehmen (Hammermann/Stettes, 2016, 26ff.). So zeigen sich stark digitalisierte Unternehmen dann auch bereits heute gut vorbereitet. Sie sind in der Personalentwicklung und Weiterbildung nicht nur engagierter, sondern auch vorausschauender (Hammermann/Stettes, 2016, 18ff.). Die systematische Analyse von Kompetenzprofilen und beruflichen Ambitionen hilft den Führungskräften, die Mitarbeiter für Veränderungen zu gewinnen und zu befähigen. Eine lernförderliche Arbeitsumgebung, altersgemischte Teams und Wissenstransfersysteme leisten die Gewähr, dass die Beschäftigten in einem digitalisierten Umfeld das erforderliche berufliche und betriebliche Erfahrungswissen aufbauen, erhalten, weiterentwickeln und auch an andere weitergeben können. Jedes zweite stark digitalisierte Unternehmen ist in dieser Hinsicht gut gerüstet. Unter den Betrieben, die sich bislang eher zurückhaltend mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen, trifft dies nur auf jeden Vierten zu.
2.1.4 Zwischenfazit I
- Es finden sich bislang keine überzeugenden empirischen Evidenzen dafür, dass im Zuge einer fortschreitenden Digitalisierung negative Beschäftigungsentwicklungen befürchtet werden müssen, weil der Einsatz digitaler Technologien neue Rationalisierungspotenziale schafft oder vorhandene ausdehnt. Dies gilt selbst für jene Beschäftigtengruppen, bei denen man aufgrund der Standardisierbarkeit und Automatisierbarkeit der Tätigkeiten am ehesten Beschäftigungseinbußen vermuten würde.
Implikation: Es ist die Hypothese erlaubt, dass Digitalisierung wie technischer Fortschritt allgemein die Möglichkeit zu Wohlstandsmehrung birgt, weil Ressourcen effektiver und effizienter eingesetzt werden können. Wo dies geschieht, wandelt sich der Inhalt bestehender Beschäftigungsverhältnisse oder es entstehen neue, und dies mag hier und da auch zu einem Abbau von Arbeitsplätzen führen.
- Die Prognosen von Beschäftigungswirkungen für einzelne Branchen und die gesamte Volkswirtschaft unterliegen ebenfalls dem Vorbehalt, dass sie in starkem Maß spekulativ sind und von den zugrunde gelegten Annahmen abhängen. Die Beschäftigungsentwicklungen der jüngeren Vergangenheit geben zumindest keinen Aufschluss über systematisch erkennbare Wirkungsketten.
Implikation: Es bleibt abzuwarten, wie im Zuge einer fortschreitenden Digitalisierung in einem Wirtschaftszweig etablierte und gegebenenfalls dominierende Geschäftsmodelle durch neue Wettbewerber (aus anderen Branchen) auf den Prüfstand geraten und welche Konsequenzen dies für die Beschäftigung in der betroffenen Branche und in der gesamten Volkswirtschaft haben wird. Dies wird nicht zuletzt davon abhängen, wie es etablierten Marktteilnehmern gelingt, Impulse zur Modifikation ihre Geschäftsmodelle aufzunehmen und welche Kosten- und Preiseffekte in der Gesamtwirtschaft durchschlagen.
- Im Zuge des Digitalisierungsprozesses steigen die Qualifikationsanforderungen an die Beschäftigten tendenziell an. Vor allem IT-Fachwissen und die berufliche Handlungsfähigkeit mit dem Medium Internet werden voraussichtlich für die Mehrzahl der Beschäftigten an Bedeutung gewinnen. Dies gilt allerdings auch für berufliches und betriebsspezifisches Erfahrungswissen sowie technisches und betriebswirtschaftliches Fachwissen. Die Digitalisierung treibt damit die Entwicklung zur Höherqualifizierung weiter voran, die bereits in den vergangenen Dekaden am deutschen Arbeitsmarkt zu beobachten war.
Implikation: IKT-bezogene Kompetenzen kristallisieren sich für die Mehrzahl der Beschäftigten als Schlüsselkompetenzen einer digitalen Arbeitswelt heraus. Sie sind die notwendige Voraussetzung, um das Potenzial digitaler Technologien am Arbeitsplatz zu nutzen. Dieses wird aber umso eher zum Tragen kommen, wo die angestammte berufliche (Fach- oder im Verlauf der Karriere erworbene) Expertise die Fähigkeit zur Anwendung und Entwicklung von zum Beispiel Computern, mobilen Endgeräten, Internet und dazugehöriger Software und Diensten wirkungsvoll ergänzen wird.
- Implikation: Die Beschäftigung in der Arbeitswelt der Zukunft wird keinem deterministischen Pfad folgen. Das hat sie auch in der Vergangenheit nicht, wie zum Beispiel der beschäftigungspolitische Erfolg hierzulande in der vergangenen Dekade zeigt. Ängste sind daher unangebracht. Die Arbeitswelt wird sich gleichwohl verändern. Sie hat sich aber bereits in den vergangenen Jahren gewandelt. Die Veränderungen werden mit Anpassungsprozessen einhergehen, die für den Einzelnen durchaus schmerzhaft sein können, anderen dagegen neue Perspektiven eröffnen.
Der Wert der analysierten Prognosen ist naturgemäß begrenzt. Die dahinter stehenden Analysen können gleichwohl als Indikatoren herangezogen werden, wie sich im digitalen Wandel Berufe oder Arbeitsplätze verändern könnten. Sie zeigen damit auch Ansatzpunkte für künftige Anpassungsstrategien auf. Veränderungsbereitschaft und Veränderungsfähigkeit werden dabei die Faktoren sein, die darüber entscheiden, auf welcher Seite – negativ Betroffene oder Begünstigte – Beschäftigte und Unternehmen stehen werden. Beide Faktoren hängen wiederum von den Kompetenzen der Betroffenen ab. Diese können jedoch aktiv aufgebaut, entwickelt und erhalten werden. Hier liegt eine große Chance für Unternehmen, Beschäftigte und Volkswirtschaft insgesamt.
Im Fokus des Grünbuchs Arbeit 4.0 des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) steht auch, in welchem Rechtsrahmen Arbeit in einer digitalisierten Wirtschaft erfolgen könnte. Dies betrifft die Fragen, wie "die Risiken durch Formen atypischer Beschäftigung und Übergänge am Arbeitsmarkt besser [abgesichert werden können]", "welche Auswirkungen […] neue Geschäftsmodelle außerhalb abhängiger Beschäftigung auf die soziale Sicherung [haben könnten]" und ob "Erwerbstätige, die […] über Online-Plattformen ihre Dienstleistungen anbieten, echte Selbständige [sind]" (BMAS, 2015a, 58 f. und 67). Im Grunde werden damit Fragestellungen aufgegriffen, wie sie in den vergangenen Jahren und gegenwärtig bereits unter dem Stichwort "atypische Beschäftigung" kontrovers diskutiert wurden und werden. Die prominente Nennung im Grünbuch lässt darauf schließen, dass das BMAS vermutet, die Digitalisierung könnte die Verbreitung flexibler Beschäftigungsformen wie Befristungen und Zeitarbeit sowie Teilzeit und Minijobs gleichermaßen beeinflussen wie auch die Inzidenz von Solo-Selbständigkeit.
Vor dem Hintergrund, dass keine gesicherten Beschäftigungsentwicklungen in bestimmten Segmenten des Arbeitsmarktes im Zusammenhang mit der Digitalisierung prognostiziert werden können (s. 2.1), müsste daher zunächst geklärt werden, warum die zunehmende Verbreitung digitaler Technologien zu einer Substitution von Beschäftigungsverhältnissen führen sollte, die für manche Beobachter als gewünschter Normalzustand gelten. Hinter einer solchen Fragestellung liegen zwei Hypothesen:
- Wenn etablierte Geschäftsmodelle auf den Prüfstand geraten bzw. der Erfolg neuer Ge-schäftsmodelle unsicher ist, könnte der Bedarf an flexiblen Beschäftigungsverhältnissen steigen. Gleiches gilt im Grunde für einen allgemeinen Anstieg der Unsicherheit im digitalen Wandel.
- Wenn die Organisation der Arbeitsprozesse flexibler wird und dabei im Zuge einer steigenden Vernetzung die Betriebsgrenzen zunehmend überschreitet, könnte der Bedarf an externer Expertise ansteigen, die als selbständige Tätigkeit temporär oder dauerhaft in den Wertschöpfungsverbund eingegliedert ist.
Daher wird nacheinander geprüft, ob sich aus der vorhandenen empirischen Evidenz Hinweise ergeben, dass im Zuge einer fortschreitenden Digitalisierung der Wirtschaft die Verbreitung von befristeten Beschäftigungsverhältnissen und Zeitarbeit (s. 2.2.1), die Teilzeitarbeit und Minijobs (s. 2.2.2) sowie von Solo-Selbständigkeit und insbesondere Crowdworkern (s. 2.2.3) zunehmen könnte.
2.2.1 Befristung und Zeitarbeit
Befristete Beschäftigung und Zeitarbeit haben sich als betriebliche Flexibilisierungsinstrumente etabliert. Sie helfen den Unternehmen, Veränderungen im wirtschaftlichen Umfeld durch eine potenzielle Flexibilisierung des Arbeitsvolumens bewältigen zu können. Sie könnten vor diesem Hintergrund an Bedeutung zunehmen, wenn erstens im Zuge des digitalen Wandels die Unsicherheit über die künftige Entwicklung der Auftragseingänge oder das Gewicht rein temporär zu erledigender Aufgaben ansteigt. Befristungen und Zeitarbeit würden dann die Möglichkeit bieten, gegenwärtige Aufträge oder Projekte durch zusätzliche Mitarbeiter bearbeiten zu können, ohne Gefahr zu laufen, Beschäftigungsanpassungen in der unbefristeten Stammbelegschaft vornehmen zu müssen, wenn die Aufträge in der Zukunft dauerhaft ausbleiben. Zweitens erlauben sie dem Unternehmen, über einen längeren Zeitraum neue Beschäftigte, ihre Kompetenzen und Leistungsbereitschaft kennenzulernen. Auf diese Weise können Unsicherheiten darüber abgebaut werden, ob Beschäftigte und Stellen zueinander passen. Wenn der digitale Wandel mit sich verändernden Kompetenzanforderungen einhergeht und vor dem Hintergrund der hohen Bedeutung von sozialen und personalen Kompetenzen sowie des Erfahrungswissens unklar ist, ob die Beschäftigten diese mitbringen, könnte auch die Funktion der Befristungen und Zeitarbeit als verlängerte Probezeit an Bedeutung gewinnen.
Allerdings weist der Verbreitungsgrad beider Beschäftigungsformen seit längerem eine bemerkenswerte Konstanz auf. So hat sich der Anteil der befristeten Beschäftigungsverhältnisse an allen abhängig Erwerbstätigen im Grunde seit 1998 nicht verändert, sieht man einmal von erhebungstechnischen Gründen ab, die zu einem Niveausprung im Jahr 2005 folgende geführt haben (Schäfer et al., 2014, 17). Im Jahr 2014 waren 9,1 Prozent der Arbeitnehmer (ohne Auszubildende) befristet beschäftigt (s. Tabelle 2-9). Der Anteil der Zeitarbeiter an allen abhängig Beschäftigten liegt seit 2007 (mit Ausnahme des Krisenjahrs 2009) bei rund 2 Prozent (Schäfer, 2015, 76). Das erhebliche strukturelle Wachstum der Zeitarbeit, das im Anschluss an ihre Deregulierung im Kontext der Hartz-Reformen zu beobachten war, scheint allerdings zum Ende gekommen zu sein. Mittlerweile pendeln die Monatszahlen der Bundesagentur für Arbeit seit geraumer Zeit in einem Korridor zwischen 850.000 und 950.000 Zeitarbeitern (BA, 2015 und 2016). Die Konstanz bei beiden Beschäftigungsformen lässt keinen direkten Zusammenhang mit dem digitalen Wandel erkennen. Allerdings ist für einen so weitreichenden Schluss ein differenzierterer Blick erforderlich.
Befristungen machen insgesamt etwas weniger als die Hälfte der Neueinstellungen (44 Prozent im Jahr 2012) aus – eine Quote, die sich seit 2004 ebenfalls kaum verändert hat (IAB, 2013). In vier von zehn Fällen werden sie im gleichen Betrieb in unbefristete Arbeitsverhältnisse umgewandelt (Tabelle 2-9; IAB, 2013, 6). Ihre Inzidenz sinkt zudem deutlich mit zunehmendem Lebensalter (Schäfer et al., 2014, 16 f.). Umwandlungen und ihr gehäuftes Auftreten in jüngeren Jahrgängen signalisieren, dass die befristete Beschäftigung tendenziell ein Übergangsphänomen in den ersten Jahren einer Erwerbsbiografie darstellt. Es liegt die Vermutung nahe, dass sich an diesem Charakter der Befristung als Beschäftigungsform im Zuge des digitalen Wandels auch wenig ändern wird. Vor diesem Hintergrund wäre dann zu erwarten, dass die Befristungsquote und der Anteil befristeter Neueinstellungen in den Branchen am höchsten wären, die unternehmensnahe Dienstleistungen anbieten und in denen der digitale Wandel besonders weit vorangeschritten ist (s. 2.1.2).
Tabelle 2-9 zeigt allerdings auf Basis von Daten aus dem IAB-Betriebspanel, dass Befristungs- und Neueinstellungsquoten in den relativ stark digitalisierten Wirtschaftszweigen Verkehr und Lagerei, Informations- und Kommunikation sowie Finanz- und Versicherungsdienstleistungen zum Teil deutlich unter dem gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt liegen. Lediglich bei den wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und freiberuflichen Dienstleistungen ist zumindest die Befristungsquote überdurchschnittlich. Auch bei Betrachtung der Daten aus dem Mikrozensus verändert sich das Bild wenig. Dies spricht gegen die Hypothese einer steigenden Bedeutung der Befristungen im digitalen Wandel. In den vier ausgewählten Wirtschaftszweigen der unternehmensnahen Dienstleistungen lässt sich aus den Übernahme- und Abgangsquoten ebenfalls kein Anhaltspunkt erkennen, ob die befristete Beschäftigung und Digitalisierung in einem sys-tematischen Zusammenhang stehen.
Mit Blick auf die Zeitarbeit lässt sich zunächst konstatieren, dass zwischen ihrer Nutzung als personalpolitisches Flexibilisierungsinstrument und dem Digitalisierungsgrad kein systematischer Zusammenhang erkennbar ist (s. Abbildung 2-2). Auch wenn mit 5,2 Prozent der Unternehmen, die sich intensiv mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen und für die das Internet eine sehr hohe Bedeutung hat, ein kleinerer Anteil Zeitarbeiter beschäftigt ist als unter den wenig digitalisierten Betrieben (8,5 Prozent), ist der Unterschied nicht signifikant. Der deskriptive Unterschied in der Nutzung von Arbeitnehmerüberlassung ist auf einen Brancheneffekt zurückzuführen. So ist der Digitalisierungsgrad von Unternehmen in den unternehmensnahen Dienstleistungen häufiger hoch als in Industriebetrieben.
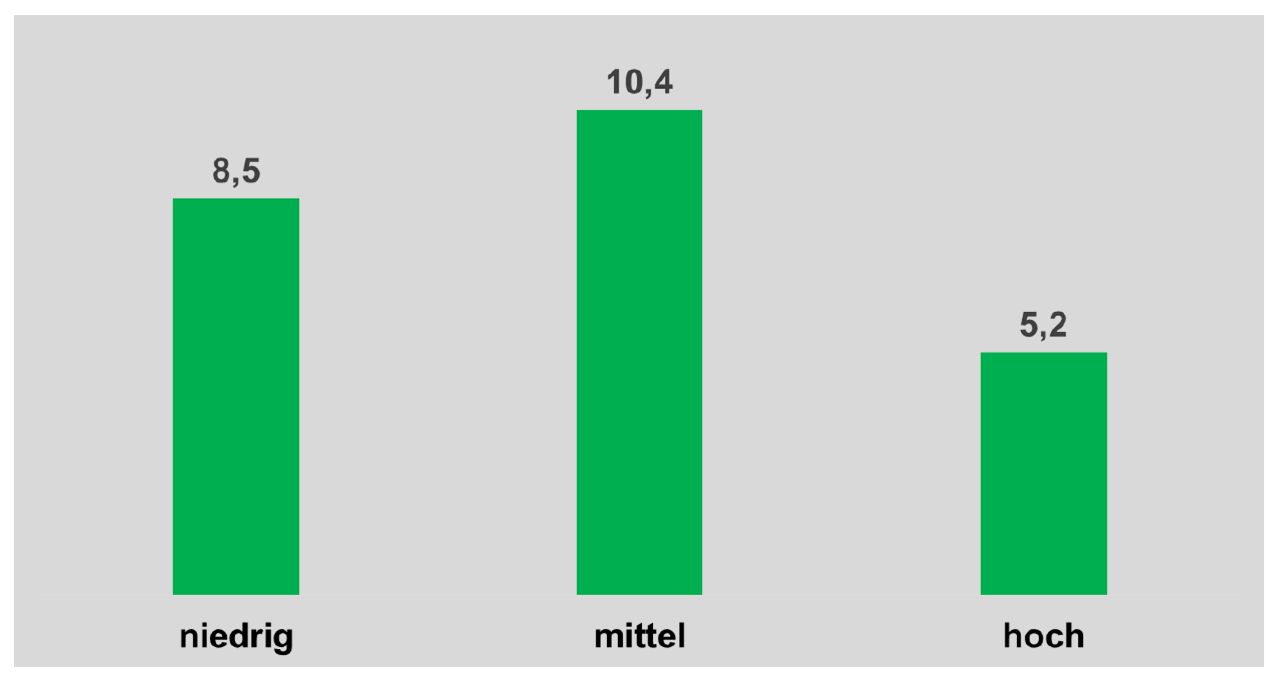 Hoch: intensive Beschäftigung mit dem Thema Digitalisierung und Internet hat eine sehr hohe Bedeutung für die Geschäftsaktivitäten. Mittel: intensive Beschäftigung mit dem Thema Digitalisierung und Internet hat eine eher hohe Bedeutung für die Geschäftsaktivitäten oder Beschäftigung am Rande mit dem Thema Digitalisierung und Internet hat eine sehr hohe Bedeutung für die Geschäftsaktivitäten. Niedrig: alle anderen.
Hoch: intensive Beschäftigung mit dem Thema Digitalisierung und Internet hat eine sehr hohe Bedeutung für die Geschäftsaktivitäten. Mittel: intensive Beschäftigung mit dem Thema Digitalisierung und Internet hat eine eher hohe Bedeutung für die Geschäftsaktivitäten oder Beschäftigung am Rande mit dem Thema Digitalisierung und Internet hat eine sehr hohe Bedeutung für die Geschäftsaktivitäten. Niedrig: alle anderen.
Auch die Analyse der Entwicklung der Beschäftigung in Tätigkeiten mit unterschiedlich hohem Anforderungsniveau ergibt keinen Hinweis auf einen spezifischen Digitalisierungseffekt auf die Zeitarbeit (s. Tabelle 2-10). Die Anzahl der Zeitarbeiter hat zwischen Juni 2013 und Juni 2015 vor allem in Helfertätigkeiten stark zugenommen (+17,6 Prozent). Dies ist gerade die Arbeitnehmergruppe, die nach gängiger Vorstellung am stärksten durch Automation bedroht sein könnte. Der Anteil der Helfer an allen Zeitarbeitern ist um gut drei Prozentpunkte auf 54 Prozent angestiegen. In allen anderen Anforderungsstufen verlief das Wachstum unterdurchschnittlich.
Nun ist denkbar, dass der überproportionale Anstieg der Helfer sich vor allem in beruflichen Tätigkeiten vollzogen hat, die nur einem geringeren Automatisierungsrisiko unterliegen oder weniger digitalisierten Branchen ausgeübt werden. Die verfügbare amtliche Arbeitnehmerüberlassungsstatistik gibt diesbezüglich keine direkten Rückschlüsse (s. Tabelle 2-11):
- Es fällt zwar zunächst auf, dass der Bestand an Zeitarbeitnehmern, die als Fahrzeug- und Transportgeräteführer tätig sind, sich um 23,5 Prozent besonders stark erhöht hat. Nun liegt auch die Vermutung nahe, dass viele Fahrzeug- und Transportgeräteführer in Betrieben des Wirtschaftszweiges Verkehr und Lagerei eingesetzt werden. Es muss aber im Auge behalten werden, dass das Substituierbarkeitspotenzial der Helfertätigkeiten in diesem Segment mit 83,3 Prozent zu den höchsten zählt. Brancheneffekt und Automatisierungseffekt würden für dieses Beschäftigtensegment entgegengesetzte Vorzeichen aufweisen.
- Ein diffuses Bild ergibt sich für die Sammelgruppe der Berufe in der Rohstoffgewinnung (21), in der Kunststoff- und Holzverarbeitung (22), den Papier- und Druckberufen (23), Berufen in der technischen Entwicklung, Konstruktion und Produktionssteuerung (27) sowie den Textil- und Lederberufen (28), in denen die Zahl der eingesetzten Zeitarbeiter überproportional ebenfalls stark angestiegen ist. Das Substituierbarkeitspotenzial für Helfer und Fachkräfte ist analog zu den Fahrzeugführern relativ hoch. Allerdings liegen die Einsatzfelder nicht in den Vorreiterbranchen in Sachen Digitalisierung.
- Die Entwicklung in den Metallberufen (24), den Fahrzeug- und Maschinenberufen (25) sowie den Mechatronik- und Elektroberufen (26) verläuft uneinheitlich. Den drei Berufs-hauptgruppen ist aber gemein, dass sie im Helfer- und Fachkräftebereich ein relativ hohes Substituierbarkeitspotenzial aufweisen. Bei den Mechatronik- und Elektroberufen gilt dies selbst für Spezialisten und Experten (Dengler/Matthes, 2015, 28).
- Ein systematisches Bild ist auch nicht für die Berufshauptgruppen erkennbar, in denen das Rationalisierungspotenzial selbst in Helfertätigkeiten eher gering ist – wie Schutz-, Sicherheits- und Überwachungsberufe (53) sowie Reinigungsberufe (54). Während der Einsatz im erstgenannten Feld gesunken ist (-5,2 Prozent), war im zweitgenannten Segment ein leichter Anstieg zu beobachten (+4,2 Prozent).
Zusammengenommen sprechen die vorliegenden Daten nicht für einen systematischen Zusammenhang zwischen der Verbreitung der befristeten Beschäftigung bzw. Zeitarbeit und dem digitalen Wandel.
2.2.2 Teilzeit und Minijobs
Gut 28 Prozent der hiesigen Arbeitnehmer arbeiten Teilzeit, darunter jeder siebte (oder 4,0 Prozent aller Beschäftigten), weil er oder sie kein Arbeitsverhältnis in Vollzeit finden konnte (s. Tabelle 2-12). Derartige unfreiwillige Teilzeit existiert zwar, bleibt aber wie in den früheren Jahren eher ein Randphänomen (Schäfer et al., 2014, 23). Das Gros der Beschäftigten – insbesondere unter den Frauen, die rund acht von zehn Teilzeitkräften stellen – verzichtet auf eine Vollzeittätigkeit aufgrund familiärer bzw. persönlicher Verpflichtungen oder aus sonstigen privaten Gründen. Vor dem Hintergrund personenbezogener Einflussfaktoren erscheint es unwahrscheinlich, dass von der Digitalisierung der Arbeitswelt ein starker positiver oder negativer Impuls auf die Verbreitung von Teilzeit in der Gesamtwirtschaft ausgehen wird.
Denkbar ist allerdings, dass in Einzelfällen die Potenziale digitaler Technologien die Möglichkeit eröffnen, die Arbeitszeit auszudehnen, wenn Wegezeiten bei einer Verlagerung des Arbeitsplatzes aus dem Betrieb zum Beispiel ins Homeoffice wegfallen. So sagen in einer kombinierten Betriebs-/Beschäftigtenbefragung zwei Drittel der Personen, die bisher nicht von zu Hause aus arbeiten, sich dies aber vorstellen könnten, dass durch die Nutzung des Homeoffice Fahrzeiten eingespart werden könnten (Arnold et al., 2015, 19). Teilzeitbeschäftigte äußern dabei signifikant häufiger den Wunsch nach mobilem Arbeiten oder der Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten (Arnold et al., 2015, 31). Dieser Befund könnte ein Potenzial für eine Ausweitung des Arbeitsvolumens anzeigen. Es liegt aber die Vermutung nahe, dass dies weniger den Verbreitungsgrad von Teilzeitbeschäftigung, sondern vielmehr das Stundenvolumen in der Teilzeitbeschäftigung beeinflussen könnte.
Tätigkeiten für Helfer und Fachkräfte machen den Löwenanteil der Einsatzfelder von ausschließlich geringfügig Beschäftigten aus (s. Tabelle 2-13). Dabei ist bei beiden Anforderungsniveaus eine relativ starke Konzentration auf wenige Berufshauptgruppen erkennbar. So arbeitet gut ein Fünftel der ausschließlich geringfügig beschäftigten Helfer im Juni 2015 in den Berufen der Berufshauptgruppe Verkehr und Logistik (ohne Fahrzeugführer). Dazu zählen zum Beispiel Abfüller oder Packer. Das Substituierbarkeitspotenzial dieses Personenkreises wird mit knapp 61 Prozent als mittelhoch eingeschätzt (Dengler/Matthes, 2015, 29). Ein weiteres gutes Viertel ist in Reinigungsberufen tätig, die nur ein geringes Automatisierungspotenzial aufweisen. Als Fachkräfte sind ausschließlich geringfügig Beschäftigte besonders in den Verkaufsberufen (mittelhohes Risiko von 40,4 Prozent), in Tourismus- und Gaststättenberufen (geringes Risiko von 19,1 Prozent) und in Berufen der Unternehmensführung/-organisation (mittelhohes Risiko von 58,5 Prozent) anzutreffen.
Vor diesem Hintergrund liegt die Vermutung nahe, dass die Digitalisierung der Arbeitswelt für sich genommen nur einen bedingten Einfluss auf die Verbreitung der geringfügigen Beschäftigung in der Gesamtwirtschaft haben wird. Dies gilt selbst dann, wenn in einzelnen Teilbereichen der Volkswirtschaft sich Geschäftsmodelle ausbreiten sollten, die einen vermehrten Einsatz von Mitarbeitern in bestimmten Spitzenzeiten eines Tages oder einer Woche erfordern sollten und bei denen sich eine geringfügige Beschäftigung als zweckmäßige Arbeitsform anbieten würde.
2.2.3 Solo-Selbständigkeit und Crowdworker
Insbesondere in den Medien, auf Gewerkschaftsseite und in der Politik wird im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Arbeitswelt diskutiert, ob das Internet in Zukunft mehr und mehr eine Plattform wird, über die Unternehmen temporär und fallweise externes Know-how einkaufen und damit eigenes Stammpersonal ersetzen bzw. deren Arbeitsstandards bewusst unterwandern können. Die IG-Metall hat zum Beispiel eigens ein Internetangebot zur Verfügung gestellt, wo man sich über das Phänomen Crowdworking informieren, austauschen und sich als Betroffener oder Interessierter vernetzen kann, weil nach eigener Aussage Crowdworking eine neue Form der Solo-Selbständigkeit ist und Millionen betrifft. Crowdworking auf der Beschäftigtenseite steht dem Crowdsourcing auf der Unternehmensseite gegenüber. Letzteres wird in Anlehnung an den Begriff "Outsourcing" als Auslagerung eines ganzen Projekts oder auch Teilaufgaben an einen bestimmten Nutzerkreis im Internet verstanden (Leimeister et al., 2012).
Nun überrascht zunächst mit dem Blick auf Deutschland, dass Crowdsourcing zwar ein prominent diskutiertes, allerdings eher ein wenig relevantes Phänomen ist. Dies gilt selbst für Unternehmen in der Informationswirtschaft, der eine Vorreiterrolle in der Umsetzung solcher Konzepte zukommen dürfte. Hier geben gerade einmal 4,2 Prozent der Unternehmen an, Crowdworking-Plattformen aktuell zu nutzen oder in absehbarer Zeit nutzen zu wollen (ZEW, 2015, 3). Lediglich im Bereich der Mediendienstleister ist der Anteil mit 9,1 Prozent deutlich höher, bleibt aber weit davon entfernt, um auf eine große Relevanz des Crowdworkings schließen zu können. Auch wenn dies lediglich eine Momentaufnahme ist, überrascht doch, dass in knapp der Hälfte der Unternehmen der Informationswirtschaft (45 Prozent) das Konzept Crowdworking dagegen noch gänzlich unbekannt ist.
Einen interessanten Hinweis, warum Crowdsourcing bzw. -working auch in Zukunft kein Massenphänomen sein könnte, vermitteln die Antworten aus der Informationswirtschaft, welche Gründe gegen den Einsatz von Crowdworkern sprechen. Knapp acht von zehn der befragten Unternehmen geben an, dass sich die Arbeitsinhalte für eine Fremdvergabe über eine Plattform schlicht nicht eignen würden (ZEW, 2015, 3). Die Hälfte sieht Schwierigkeiten bei der Qualitätskontrolle. Etwas weniger sehen juristische Unsicherheiten und das Risiko, dass sensibles unternehmensinternes Wissen an Externe abfließt. Schwierigkeiten bei der technischen Umsetzung sahen hingegen nur drei von zehn. Die Antworten deuten darauf hin, dass für eine Vergabe über Plattformen an Externe weniger die technischen Möglichkeiten entscheidend sind, sondern vielmehr die Transaktionskosten, die mit einer solchen Vergabe verbunden wären. Die genannten transaktionskostenbezogenen Gründe sind aber zeitinvariant und unabhängig von der weiteren Entwicklung im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Wirtschaft und Arbeitswelt.
Eine Befragung von 408 Crowdworkern, die ihre Dienste über zwei Internetplattformen anbieten, signalisiert bei aller Vorsicht aufgrund der Stichprobengröße und -zusammensetzung, dass es sich weniger um ein Massenphänomen, sondern vielmehr um eine sehr spezifische Erwerbsform handelt. So sind Crowdworker nicht nur deutlich jünger als andere Erwerbstätige, sondern üben diese Tätigkeit häufig auch nur als Nebenbeschäftigung zu einer abhängigen Beschäftigung oder einer betrieblichen bzw. akademischen Ausbildung aus (Bertschek et al., 2015).
Grundsätzlich lässt sich das Phänomen Crowdwork nicht klar von einer klassischen freiberuflichen Mitarbeit trennen (Bertschek et al., 2015, 3). Vor diesem Hintergrund bietet sich daher an, die empirische Relevanz eines potenziellen Digitalisierungseffektes hinsichtlich einer "neuen Selbständigkeit" zusätzlich anhand der Struktur und Entwicklung der Verbreitung von Solo-Selbständigkeit bzw. der freiberuflichen Tätigkeit einzuschätzen. Dabei fällt zunächst auf, dass die Anzahl der Solo-Selbständigen in der vergangenen Dekade im Großen und Ganzen konstant geblieben ist (s. Abbildung 2-3). Dies gilt auch bei einer Differenzierung zwischen Solo-Selbständigkeit im Haupt- und Zugewerbe (IfM Bonn/Statistisches Bundesamt, 2015, 53 ff.). Ein ähnliches Bild ergibt sich, wenn man die Entwicklung des Anteils der freiberuflichen Mitarbeiter in den hiesigen Betrieben betrachtet (BA, 2012, 35). Hinweise, die die Hypothese einer zunehmenden Verbreitung neuer Selbständigkeit vor diesem Hintergrund stützen können, finden sich aus diesem Blickwinkel nicht.
Auch bei einer Betrachtung der Solo-Selbständigkeit nach Wirtschaftszweigen ergibt sich kein Anhaltspunkt dafür, dass sich im Zuge des digitalen Wandels diese Erwerbsform ausbreiten würde. So ist zwischen 2011 und 2014 die Anzahl der Solo-Selbständigen in den relativ stark digitalisierten Bereichen Verkehr, Lagerei und Kommunikation sowie Grundstücks- und Wohnungswesen/wirtschaftliche Dienstleistungen gesunken, im Bereich Finanz- und Versiche-rungsdienstleistungen konstant geblieben (s. Tabelle 2-14). Gegenüber 2009 ist ein leichter Anstieg im Bereich Grundstücks- und Wohnungswesen/wirtschaftliche Dienstleistungen, im Bereich Finanz- und Versicherungsdienstleistungen hingegen ein Rückgang zu verzeichnen, bei dem allerdings zu beachten ist, dass aufgrund eines veränderten Hochrechnungsverfahrens die entsprechenden Zahlenwerte nur eingeschränkt vergleichbar sind.
2.2.4 Zwischenfazit II
- Befristete Beschäftigung ist ein etabliertes betriebliches Flexibilisierungsinstrument, was den Betrieben die Möglichkeit eröffnet, die Entwicklung der Auftragslage abzuwarten, bevor es zu einer Festeinstellung kommt. Sie weist wesentliche Merkmale eines Übergangsphänomens auf und betrifft insbesondere jüngere Altersjahrgänge. Ein Zusammenhang mit dem digitalen Wandel ist hingegen nicht zu erkennen.
Auch die Zeitarbeit ermöglicht es Unternehmen, Auftragsschwankungen ohne Anpassung der Stammbelegschaften abzufedern oder auf kurzfristig entstehende Engpässe an be-stimmten Kompetenzen zu reagieren. Der Blick auf die schwerpunktmäßigen Einsatzbereiche und das dominierende Anforderungsniveau spricht genauso wenig für einen systematischen Zusammenhang mit der Digitalisierung wie die Beschäftigungsentwicklung in diesen Bereichen. Zudem zeigen Unternehmensbefragungen, dass die Wahrscheinlichkeit des Einsatzes von Zeitarbeitern in hochdigitalisierten Unternehmen sich nicht signifikant von jener in relativ wenig digitalisierten Betrieben unterscheidet.
Implikation: Befristete Beschäftigung und Zeitarbeit stehen (derzeit) in keinem direkten systematischen Zusammenhang mit der Digitalisierung der Wirtschaft und Arbeitswelt. Sie haben sich aber als betriebliche Flexibilisierungsinstrumente etabliert, mit denen die Betriebe sich an Veränderungen im betrieblichen Umfeld anpassen können. Da die Volatilität im Zuge der Digitalisierung nicht geringer werden dürfte, werden beide Beschäftigungs-formen ihre Bedeutung für Unternehmen auch in einer digitalisierten Wirtschaft beibehalten.
- Auch bei Teilzeitbeschäftigung und geringfügiger Beschäftigung spricht die empirische Evidenz eher gegen einen systematischen Zusammenhang mit einer zunehmenden Digitalisierung. Erstere ist insbesondere von Erwägungen getrieben, die sich aus Bedingungen im privaten Umfeld der Beschäftigten ergeben. Letztere konzentriert sich auf Helfer- und Fachkräftetätigkeiten und dabei insbesondere auf Einsatzbereiche, bei denen das Substituierbarkeitspotenzial allenfalls als mittelhoch eingeschätzt wird.
Implikation: Es ist nicht zu erwarten, dass sich im Zuge einer fortschreitenden Digitalisierung der Verbreitungsgrad von Teilzeitbeschäftigung und Minijobs systematisch verändern wird. Es bleibt gleichwohl abzuwarten, ob die Möglichkeiten zur räumlichen und zeitlichen Flexibilisierung (s. 2.3.2) zu einem Wandel der Präferenzen auf der Beschäftigtenseite führen, in dessen Folge die Nachfrage nach Teilzeitbeschäftigung steigen oder sinken könnte.
- Auch für die massive Ausbreitung neuer Formen der (Solo-)Selbständigkeit finden sich keine empirischen Anhaltspunkte. Das Phänomen der Crowdworker ist selbst in einer Vor-reiterbranche der Digitalisierung, der Informationswirtschaft, im Grunde nicht bekannt und erscheint dem Gros der Unternehmen aus Transaktionserwägungen auch nicht als attraktive Erwerbsform.
Die Verbreitung von Solo-Selbständigkeit hat sich insgesamt kaum verändert. Auch ein vertiefender Blick in ausgewählte Wirtschaftsunterbereiche, die tendenziell als Vorreiter-branchen der Digitalisierung betrachtet werden, spricht derzeit nicht für einen massiven Aufwuchs von Solo-Selbständigen im Zuge des digitalen Wandels.
Implikation: Die Diskussion um neue Formen der Selbständigkeit steht in einem merklichen Kontrast zur empirischen Evidenz. Anhaltspunkte, warum sie im Zuge der Digitalisierung an gesamtwirtschaftlicher Bedeutung gewinnen könnten, gibt es derzeit abseits anekdotischer Berichterstattung keine. Analog zur Diskussion um potenzielle Beschäftigungseffekte der Digitalisierung werden in der öffentlichen Diskussion nur die Risiken der technologischen Möglichkeit der Fremdvergabe betont, herkömmliche transaktionskosten- und effizienzorientierte organisatorische Aspekte, die über Vergabe von Aufgaben an Externe – in welcher konkreten Form auch immer – außer Acht gelassen werden. Es bleibt folglich abzuwarten, ob und in welcher Form digitale Technologien neue Möglichkeiten für eine selbständige Erwerbstätigkeit eröffnen und wie diese dann zu bewerten sind.
2.3 Arbeitsbedingungen in einer digitalisierten Arbeitswelt
Neben den Fragen, in welchem Umfang Beschäftigung auf- oder abgebaut und in welcher Form sie organisiert wird, bewegt Medien und die Politik auch, wie Beschäftigten auch im digitalen Wandel an dem wirtschaftlichen Erfolg materiell beteiligt werden können (BMAS, 2015a, 58). In diesem Zusammenhang sind zwei Aspekte zu beachten. Erstens stehen die materiellen Auswirkungen des digitalen Wandels zum Beispiel auf die individuelle Lohnhöhe, die Ausgestaltung des Entgeltsystems und die betriebliche Beschäftigungssicherheit in engem Zusammenhang mit den bereits beschriebenen potenziellen Qualifikations- und Beschäftigungsauswirkungen und ihren Implikationen für die Arbeitsnachfrage. Zweitens stellt sich die Frage, ob im digitalen Wandel die Bedeutung der Tarifvertragsparteien als gestaltende Akteure auf dem Arbeitsmarkt ansteigt oder abnimmt.
Darüber hinaus wird im Zusammenhang mit dem Potenzial digitaler Technologien, die Organisation der Arbeit weiter zeitlich und räumlich zu flexibilisieren, die Frage diskutiert, wie das Arbeitsumfeld der Beschäftigten in Zukunft aussehen und welche Konsequenzen dies auf die Arbeitsbedingungen mit sich bringen könnte (BMAS, 2015a, 64 ff.). Derartige immaterielle Auswirkungen berühren zum einen Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Zum anderen adressieren sie Aspekte des Datenschutzes, wenn der Einsatz digitaler Technologien umfangreiche Informationen über das Verhalten und Eigenschaften der einzelnen Arbeitnehmerin bzw. des einzelnen Arbeitnehmers generiert.
Beide Aspekte, materielle und immaterielle Auswirkungen des digitalen Wandels, stehen für potenziellen Entwicklungen bei der Qualität der Arbeit. In diesem Zusammenhang ist dann aber stets zu beachten, dass die Wahrnehmung, ob auf einem Arbeitsplatz gute oder schlechte Arbeitsbedingungen vorherrschen, individuell höchst unterschiedlich sein kann (Schäfer et al., 2014). Dieser Gesichtspunkt ist vor allem dort von hoher Relevanz, wo keine technische Grenzwerte existieren, aus denen man Rückschlüsse auf Gesundheitsgefährdungen ziehen könnte, die im Zusammenhang mit dem Arbeits- und Gesundheitsschutz angegangen werden sollten.
2.3.1 Qualität der Arbeit – materielle Komponenten
Wenn sich wie in Abschnitt 2.1 gezeigt bislang noch keine systematischen Beschäftigungseffekte der Digitalisierung erkennen lassen, könnten sich ihre Auswirkungen gleichwohl bereits in der Lohnstruktur bzw. in deren Veränderungen widerspiegeln. Der digitale Wandel könnte sich theoretisch beschäftigungsneutral vollziehen (mit Blick auf das einzelne Unternehmen, einzelne Branchen oder die Volkswirtschaft), wenn sich die Löhne der positiv und negativ betroffenen Beschäftigtengruppen entsprechend optimal noch oben und unten anpassen würden. Nun erlaubt der Digitalisierungsgrad der Unternehmen für sich genommen derzeit aber noch keine Aussage über den nachhaltigen Erfolg oder Misserfolg der betroffenen Betrieben oder Branchen. Vor diesem Hintergrund sind daher keine Aussagen über die relativen Verdienstperspektiven und Veränderungen bei den relativen Löhnen in den stark digitalisierten Bereichen der Wirtschaft möglich. Die bisherigen Analysen deuten aber zumindest die Tendenz an, dass die Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften im Zusammenhang mit der Digitalisierung hoch sein könnte, insgesamt eher ansteigen dürfte und damit der Höherqualifizierungstrend der Vergangenheit anhalten wird. Dies impliziert für die Zukunft eine steigende Lohnspreizung zwischen Hoch- und Geringqualifizierten, und zwar unabhängig davon, ob die Löhne für Letztere fallen oder steigen.
Eichhorst et al. (2015, 16 ff.) bieten einen umfassenden Überblick über die empirische Literatur zur Entwicklung der Lohnstruktur in Deutschland. Den aufgeführten Studien zufolge ist zwi-schen 1995 und 2010 ein Anstieg der Lohnungleichheit in Deutschland zu beobachten gewesen. Auch in ihrer eigenen empirischen Untersuchung finden sie Evidenz für eine zunehmende Lohnspreizung (Eichhorst et al. 2015, 36). Auch Möller (2016) signalisiert eine markante Divergenz in der Verdienstentwicklung in diesem Zeitraum. In Westdeutschland ist zum Beispiel das Verhältnis des Lohnes eines männlichen Vollzeitbeschäftigten im 85%-Perzentil der Lohnvertei-lung zum Verdienst der Arbeitnehmer im 15%-Perzentil von dem etwa 2-fachen zu Beginn der 1990er Jahre auf fast das 2,7-fache im Jahr 2011 angestiegen (s. Abbildung 2-4). Seitdem ist aber kein weiterer Anstieg der Lohnungleichheit festzustellen.
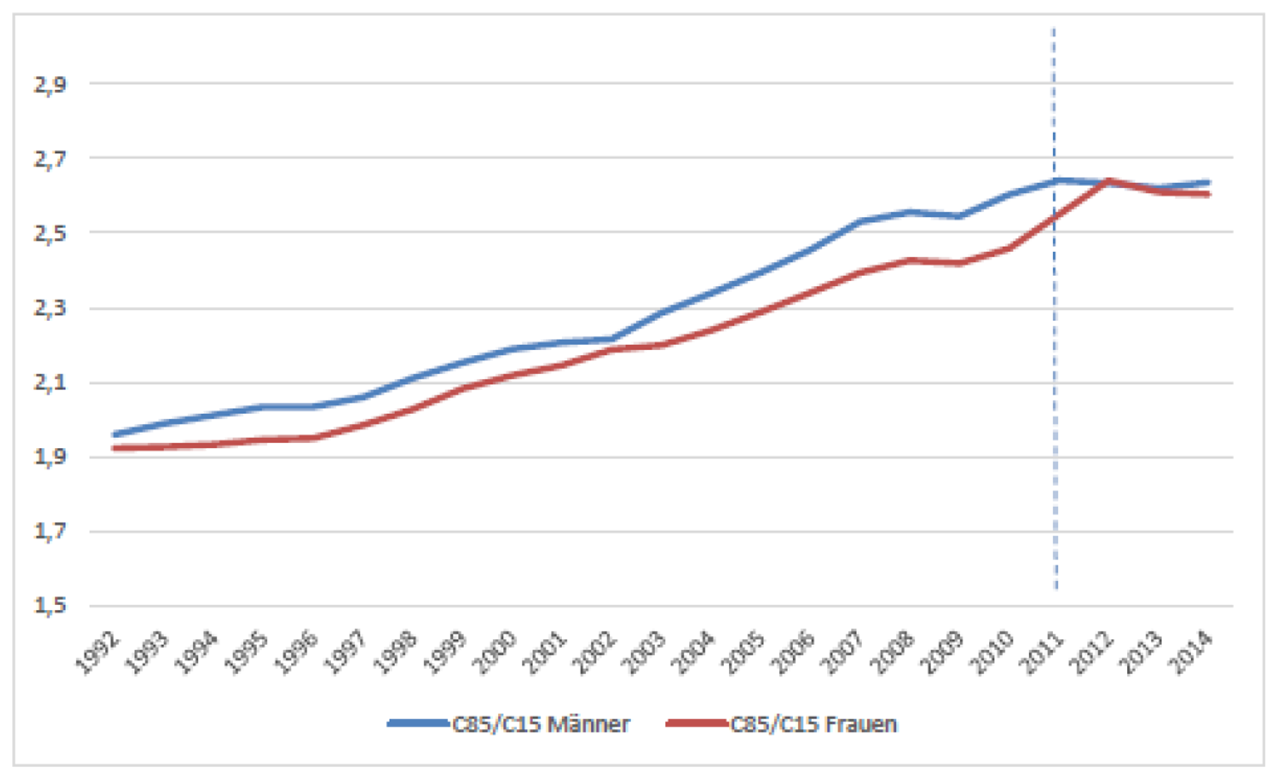 Anmerkung: Eigene Berechnung mit IEB Daten; nur Personen im Alter von 20 bis 65, keine Auszubildenden; Cx bezeichnet das x-te Perzentil der Verteilung der Bruttoverdienste pro Kalendertag für alle Personen, die zum Stichtag 30.06 des jeweiligen Jahres in Vollzeit sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren; vertikale Linie im Jahr 2011 markiert eine Änderung in der Erfassung der Teilzeit; die systematische Untererfassung der Teilzeit vor dem Jahr 2011 wurde durch ein Imputuionsverfahren korrigiert. Der Wert für die 2011 bei den Frauen wurde linear interpoliert.
Anmerkung: Eigene Berechnung mit IEB Daten; nur Personen im Alter von 20 bis 65, keine Auszubildenden; Cx bezeichnet das x-te Perzentil der Verteilung der Bruttoverdienste pro Kalendertag für alle Personen, die zum Stichtag 30.06 des jeweiligen Jahres in Vollzeit sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren; vertikale Linie im Jahr 2011 markiert eine Änderung in der Erfassung der Teilzeit; die systematische Untererfassung der Teilzeit vor dem Jahr 2011 wurde durch ein Imputuionsverfahren korrigiert. Der Wert für die 2011 bei den Frauen wurde linear interpoliert.
Zwischen Lohnzuwächsen und Beschäftigungsentwicklung ist allerdings kein systematisches Muster zu erkennen. So weisen zum Beispiel die Berufsgruppe 21 (Physiker, Mathematiker und Ingenieurwissenschaftler) und die Berufsgruppe 31 (Fachkräfte der Physik und den Ingenieurwissenschaft) zwischen 1995 und 2010 zugleich relativ hohe Medianlohn- und Beschäftigungszuwächse auf (s. Abbildung 2-5). Beide zählen zugleich zu den bestbezahltesten Beschäftigtengruppen (s. Abbildung 2-6). Relativ hohe Medianlohnzuwächse verzeichnen auch Bediener stationärer und verwandter Anlagen (Berufsgruppe 81) sowie Maschinenbediener und Montierer (Berufsgruppe 82). Deren Beschäftigungsentwicklung verlief allerdings unterproportional. In anderen Berufsgruppen – zum Beispiel die Hilfsarbeiter in der Industrie, Bau und Transportwesen (Berufsgruppe 93) – ist die Beschäftigung kräftig gewachsen, die Medianlöhne hingegen sind absolut und relativ am stärksten gesunken. In Mineralgewinnungs- und Bauberufen (Berufsgruppe 71) verliefen beide Entwicklungen negativ. Grundsätzlich haben sich die Löhne vor allem innerhalb der Berufsgruppen auseinander entwickelt (Eichhorst et al., 2015, 39). Dies gilt in der Regel unabhängig von der Beschäftigungsentwicklung in einer Berufsgruppe und beson-ders stark dort, wo die Bruttomedianlöhne relativ kräftig gewachsen sind.
Eichhorst et al. (2015, 51 ff.) zeigen zudem, dass Berufe, in denen interaktive Tätigkeiten wie Koordinieren, Verhandeln, Organisieren oder Beraten eine große Rolle spielen, im Zeitablauf besser entlohnt worden sind. Vor dem Hintergrund der hohen Bedeutung derartiger sozialer Kompetenzen in stark digitalisierten Unternehmen und deren erwarteten Bedeutungszuwachses in der kommenden Dekade (s. Tabelle 2-7) ist mit einer Fortsetzung dieses Trends zu rechnen. Berufe mit einem großen Gewicht kognitiver Routinetätigkeiten – darunter fallen Aktivitäten wie Kalkulieren, Redigieren oder Messen – und manueller Nicht-Routine-Tätigkeiten (z. B. Reparieren oder Bedienen) sind Eichhorst et al. (2015) zufolge mit zunehmend geringeren Löhnen verbunden, bei analytischen Tätigkeiten (i.e. Analysieren, Evaluieren oder Interpretieren) sind keine Veränderungen bei den Löhnen zu erkennen und bei manuellen Routinetätigkeiten ist sogar ein Anstieg zu verzeichnen. Allerdings sind die beiden letztgenannten Aspekte nur bedingt in das Bild eines digitalen Wandels zu integrieren, in dem manuelle Routinetätigkeiten am stärksten von Automation betroffen sein könnten und analytische Fähigkeiten an Gewicht gewinnen, weil die Komplexität der Arbeitsaufgaben zunimmt.
Verschiedene empirische Erhebungen kommen zum Ergebnis, dass höherqualifizierte Personen im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) zu den überdurchschnittlich vergüteten Berufsgruppen zählen (z. B. Anger et al., 2015, 19; Eichhorst et al., 2015, 40; Flake et al., 2016, 149). Wenn im digitalen Wandel technische und IT-bezogene Fachkenntnisse wie gezeigt voraussichtlich an Bedeutung gewinnen werden, dann ist auch zu erwarten, dass die Lohnprämie für entsprechend qualifizierte Beschäftigte ansteigen wird (vorausgesetzt, dass Angebot steigt nicht schneller). Ob sich dadurch Veränderungen in der Lohnstruktur ergeben, bleibt aber offen. Die Beschäftigten selber gehen mehrheitlich davon aus, dass technologische Neuerungen die eigene Produktivität steigern (s. Tabelle 2-15). Der Optimismus wird auch von niedrig qualifizierten Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen geteilt (BMAS, 2016a, 19). Er ist besonders groß in industriellen Berufen, aber auch Beschäftigte im Lebensmittel- und Gastgewerbe sind von der produktivitätssteigernden Wirkung des technischen Fortschrittes auf die eigene Leistung überzeugt. Produktivitätssteigerungen erlauben Lohnzuwächse jenseits veränderter Knappheitsprämien. Sollten sich die Erwartungen der Beschäftigten erfüllen, dürften vorsichtig interpretiert sich viele Beschäftigte von der Digitalisierung bessere Einkommensperspektiven erhoffen. Vor diesem Hintergrund überrascht es wenig, dass lediglich eine kleine Minderheit von weniger als fünf Prozent der hiesigen Beschäftigten die Sorge umtreibt, ihr Arbeitsplatz könnte durch die Einführung neuer Technologien in den nächsten Jahren auf den Prüfstand geraten (s. Abbildung 2-7). Mit Blick auf materielle Aspekte gehen auch die Betroffenen eher selten davon aus, dass sich der digitale Wandel für sie negativ auswirken wird.
Gleichwohl ist es derzeit noch zu früh, empirisch fundierte Aussagen darüber zu treffen, wie sich die Digitalisierung auf die Lohnentwicklung und auf die Lohnstruktur auswirken wird. Es muss zudem beachtet werden, dass Lohneffekte nicht nur durch die Digitalisierung selber unmittelbar erzeugt werden, sondern auch nachgelagerte makro-ökonomische Kreislaufeffekte sowohl die Entwicklung des Lohnniveaus als auch der Lohnstruktur beeinflussen können. Vorstellbar ist, dass die Digitalisierung noch einmal einen Schub für flexible Verdienstbestandteile wie Prämiensysteme oder Gewinnbeteiligungen bringen könnte. Wenn im Zuge des Einsatzes und der Vernetzung digitaler Technologien zugleich auch Entscheidungs- und Ergebnisverantwortung an diejenigen delegiert wird, die über die maßgebliche Kompetenz für Entscheidungen und Problemlösungen verfügen, könnte auch der Bedarf an Anreizinstrumenten steigen, die in einem von Informationsasymmetrien geprägten Verhältnis zwischen Geschäftsführung und Beschäftigten das Verhalten Letztere in Richtung der Unternehmensziele lenken. Für diese Hypothese spricht, dass Betriebe, die mobiles Arbeiten anbieten (hier: Arbeiten von zu Hause aus, nicht von unterwegs (s. Abschnitt 2.3.2)), signifikant häufiger über Ziele führen als Unternehmen, die kein Arbeiten im Homeoffice vorsehen (Arnold et al., 2015, 5 und 24). Dies gilt insbesondere für die Beschäftigten, die im Rahmen der regulären Geschäftszeiten ihren Arbeitsplatz aus dem Betrieb nach Hause verlegen (Arnold et al., 2015, 26). Auch bei einer flexiblen Vergütungsstruktur bleiben die Konsequenzen offen. In der Regel führen variable Vergütungsbestandteile zu einer pro-zyklischen Anpassung der Löhne und Arbeitskosten und damit einer Stabilisierung der Beschäftigung auf der Unternehmensebene (Berthold/Stettes, 2002).
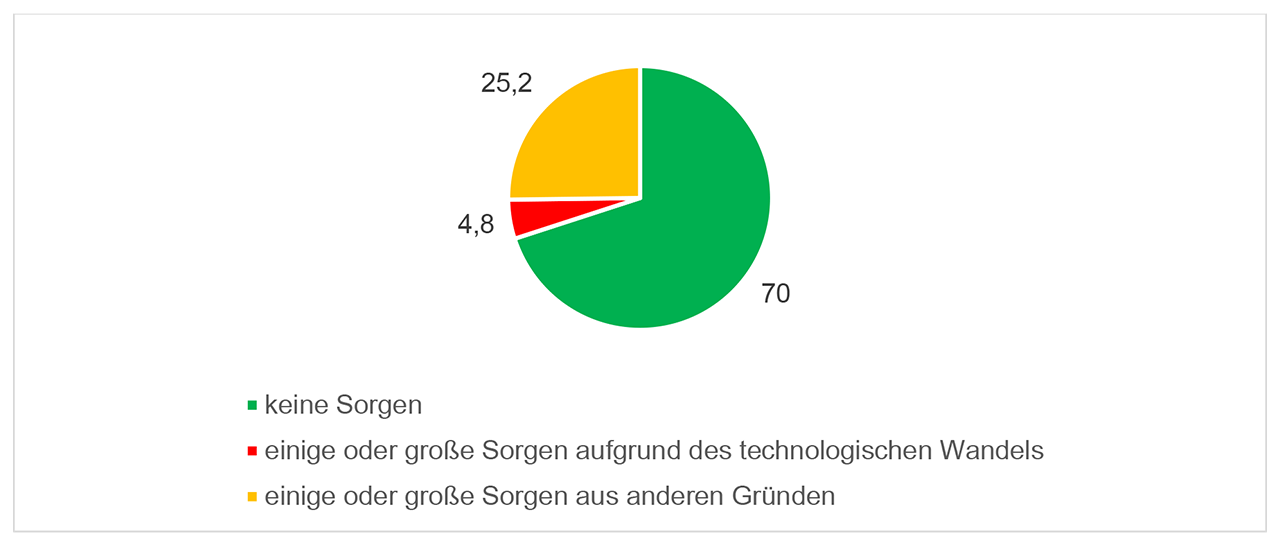 Filterfrage im Linked-Personnel-Panel: "Machen Sie sich Sorgen um die Sicherheit Ihres Arbeitsplatzes" (30 Prozent). Anschlussfrage für Personen mit Sorgen: "Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass aufgrund der technologischen Entwicklung Ihre Arbeit in den nächsten zehn Jahren durch Maschinen übernommen wird?"
Filterfrage im Linked-Personnel-Panel: "Machen Sie sich Sorgen um die Sicherheit Ihres Arbeitsplatzes" (30 Prozent). Anschlussfrage für Personen mit Sorgen: "Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass aufgrund der technologischen Entwicklung Ihre Arbeit in den nächsten zehn Jahren durch Maschinen übernommen wird?"
2.3.2 Qualität der Arbeit – immaterielle Aspekte
Digitale Technologien erweitern die Möglichkeiten, Arbeitsort und Arbeitszeit zu flexibilisieren. Mobile Endgeräte erlauben es, auch außerhalb der eigentlichen Betriebsstätte oder eines Arbeitsplatzes im eigenen Haus (Stichwort: Telearbeit, Heimarbeit) beruflich aktiv zu werden, auf interne Netzwerke und Informationsquellen zurückzugreifen, Prozesse zu überwachen, zu steuern und zu planen sowie mit betrieblichen oder externen Partnern zu kommunizieren. Auch die Restriktion eines bestimmten zeitlichen Rahmens kann dadurch weiter aufgeweicht werden, weil die Pflege von beruflichen Kontakten nicht mehr an die Anwesenheit an einem bestimmten Ort gebunden sein muss. Internetfähige mobile Geräte werden bevorzugt an Führungskräfte ausgegeben (s. Abbildung 2-8 – obere Hälfte). Smartphones, Tablets oder Notebooks gehören für Führungskräfte in großen Unternehmen zur Standardausstattung. Auch in kleinen und mittleren Betrieben ist die große Mehrheit der Beschäftigten mit Führungsverantwortung mit entsprechenden Geräten ausgestattet. Bei den Beschäftigten ohne Führungsverantwortung liegen die Anteile deutlich darunter.
Die Ausstattung mit digitalen Endgeräten korreliert mit der potenziellen Nutzungsmöglichkeit des Homeoffices (BMAS, 2016, 9). Allerdings ist ein Homeoffice nicht gleichzusetzen mit mobilem Arbeiten, denn die Ausübung beruflicher Aufgaben ist auch mit einer stationären Informa-tions- und Kommunikationsausrüstung möglich. Es ergibt sich gleichwohl ein ähnliches Bild bei der Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Auch hier ist ein deutlicher Unterschied zwischen Beschäftigten mit und ohne Führungsverantwortung zu beobachten (s. Abbildung 2-8 – untere Hälfte). Dieser Unterschied erweist sich auch in multivariaten Analysen als signifikant (Arnold et al., 2015, 25). Personen, die einen relativ großen Handlungsspielraum in ihrem Job aufweisen (bei separater Betrachtung der Geschlechter gilt dies allerdings nur für die Frauen), und solche, die unter Termindruck arbeiten und mehrere Aufgaben erledigen müssen, nutzen ebenfalls häufiger das Homeoffice. Auffällig ist auch, dass Beschäftigte, die das Homeoffice nutzen, signifikant mehr Überstunden machen. Insgesamt arbeitet knapp ein Drittel der Angestellten in Betrieben mit 50 und mehr Beschäftigten zumindest gelegentlich von zu Hause aus, unter den Arbeitern sind es mit 2 Prozent hingegen nur sehr wenige (Arnold et al., 2015, 7). Andere, etwas ältere Studien signalisieren, dass die Anzahl der Personen, die zumindest gelegentlich von zu Hause aus arbeiten, bei rund einem Fünftel liegt (DAK, 2013, 90).
Mehr als die Hälfte der Beschäftigten, die das Homeoffice nutzen, werden dann außerhalb der regulären Geschäftszeiten tätig (Arnold et al., 2015, 9). Dies gilt insbesondere für männliche Führungskräfte und Beschäftigten mit Termindruck und mehreren Arbeitsaufgaben (Arnold et al., 2015, 26). Auffällig ist zudem, dass bei weiblichen Beschäftigten die Wahrscheinlichkeit ansteigt, zumindest gelegentlich im Homeoffice zu arbeiten, wenn im eigenen Haushalt Kinder unter 14 Jahren zu betreuen sind. Dies gilt tendenziell in der Gruppe, die den betrieblichen mit dem heimischen Arbeitsplatz im Rahmen der üblichen Arbeits- bzw. Geschäftszeiten tauscht, auch für männliche Mitarbeiter. Dies signalisiert, dass mobiles Arbeiten bzw. Arbeiten im Homeoffice einen Beitrag zur Verbesserung der Vereinbarkeit von familiären und beruflichen Anforderungen leisten kann. Dies bestätigen auch Aussagen der Beschäftigten. Drei Viertel der Beschäftigten, die im Rahmen der üblichen Arbeits- bzw. Geschäftszeiten zu Hause tätig werden, versprechen sich eine bessere Balance zwischen Beruf und Privatleben (s. Tabelle 2-16). Unter den Personen, die das Homeoffice eher außerhalb der üblichen Arbeits- bzw. Geschäftszeiten nutzen, sind es immerhin noch drei von zehn. Hinzu kommt noch, dass die Beschäftigten in gleichem Umfang auch den Vorteil sehen, Fahrzeiten einzusparen. Der Zeitgewinn steht dann für andere (berufliche oder private) Zwecke zur Verfügung. Vor dem Hintergrund der Einschätzung von Beschäftigten, die bereits das Homeoffice nutzen, verwundert es wenig, dass drei von vier Personen, denen noch kein Arbeiten von zu Hause möglich ist, sich von der Homeofficenutzung eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie knapp zwei von drei sich eine Reduzierung von Pendelzeiten und mehr Freizeit erhoffen (BMAS, 2015b, 16.). Der Wunsch nach einer Nutzungsmöglichkeit besteht insbesondere bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, in deren Haushalt mindestens ein Kind unter 14 Jahren lebt (Arnold et al., 2015, 30).
Diese empirischen Befunde bestätigen die Evidenz, die auch für das Arbeiten in einem digitalisierten Arbeitsumfeld allgemein gefunden wird. Arbeitnehmer, die an einem Internetarbeitsplatz mit anderen Akteuren vernetzt arbeiten, weisen signifikant häufiger die Möglichkeit auf, bei der Planung der eigenen Arbeitszeiten auf ihre familiären und privaten Belange Rücksicht nehmen zu können (Hammermann/Stettes, 2015b, 130). Während dies auf knapp zwei Drittel dieses Beschäftigtenkreises in Deutschland zutrifft, sagt dies nur gut die Hälfte der Personen, die relativ isoliert, ohne Zugang zum Internet bzw. ohne Computer ihre Aufgaben verrichten.
Tabelle 2-16 signalisiert schließlich, dass beide Homeofficenutzergruppen neben Vereinbarkeitsaspekten auch berufliche Vorteile sehen. Da insbesondere Führungskräfte außerhalb der regulären Arbeits- und Geschäftszeiten zu Hause arbeiten, überrascht es auch nicht, dass der Anteilswertunterschied, der noch bei den Vorteilen eingesparte Fahrzeiten und bessere Vereinbarkeit zu beobachten ist, sich deutlich reduziert bzw. nahezu verschwindet, wenn hervorgehoben wird, dass sich Aufgaben im Homeoffice besser erledigen oder noch beenden lassen. Wenn digitale Technologien berufliche Aktivitäten räumlich und zeitlich flexibilisieren, bleibt es auch nicht aus, dass Personen, die von den Flexibilisierungsspielräumen Gebrauch machen, während der Freizeit angerufen oder angemailt werden bzw. auf Anfragen reagieren. Allerdings wird nur einer Minderheit der Beschäftigten in Betrieben mit 50 und mehr Mitarbeitern einige Male in der Woche kontaktiert (s. Abbildung 2-9). Arbeiter betrifft es dies fast gar nicht und unter den Angestellten ist es gerade einmal jeder Fünfte. Führungskräfte sind signifikant häufiger für dienstliche Belange in der Freizeit erreichbar (Arnold et al., 2015, 27). Gleiches gilt auch für Personen mit Handlungsspielraum bei der Gestaltung der Arbeitsaufgaben, solche mit Termindruck und Multitasking-Anforderungen und einer größeren Anzahl von Überstunden. Männer, die sich (zumindest) gelegentlich ins Homeoffice begeben, weil in ihrem Haushalt Kinder unter 14 Jahren leben, sind ebenfalls in der Freizeit eher erreichbar, Frauen hingegen nicht.
Die Befunde auf Basis des Linked-Personnel Panels, dass lediglich eine Minderheit von rund einem Fünftel der Beschäftigten (und weniger) und insbesondere Führungskräfte in ihrer Freizeit beruflich erreichbar sind, spiegeln damit die Evidenz anderer Studien wider (z. B. DGUV, 2012, 20ff.; DAK, 2013, 84 und 87). Interessanterweise sind die wichtigsten Gründe, warum Beschäftigte oft oder immer für dienstliche Belange erreichbar sind, weniger die Erwartungshal-tung der eigenen Führungskräfte oder Anforderungen der Aufgabe, sondern vielmehr die eigene Motivation (DGUV, 2012, 22). Dazu zählt, dass man gerne arbeitet, gerne auf dem Laufenden ist oder es als zweckmäßig erachtet.
Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass Personen signifikant eher im Homeoffice arbeiten, wenn sie Überstunden leisten, unter Termindruck stehen oder vielfältige Aufgaben zu erledigen haben. Ferner empfinden zwei Drittel der Beschäftigten in Betrieben mit 50 und mehr Mitarbeitern, dass die technologischen Neuerungen die Arbeit verdichtet haben, und die Hälfte der höherqualifizierten Arbeitnehmer sieht sich mit einer schwer zu bewältigenden Menge an Informationen konfrontiert (BMAS, 2016, 11 und 15). Diese Anteile sind deutlich größer als die Anteile derer, die von einer spürbaren körperlichen Entlastung (29 Prozent) oder von geringeren Kompetenzanforderungen berichten (15 Prozent). Dieser Umstand könnte bei manchem Beobachter die Sorge bestätigen, dass der digitale Wandel mit einer (psychischen) Überlastung der Beschäftigten verbunden sein könnte. Allerdings ist in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, dass Merkmale beruflicher Tätigkeiten wie Multitasking, Termin- und Zeitdruck und Informationsbewältigung erstens von den Betroffenen sehr unterschiedlich erlebt werden können und zweitens die eigenen Kompetenzen und Handlungsmöglichkeiten einen erheblichen Einfluss darauf haben, ob ein Arbeitsplatzmerkmal auch als belastend empfunden wird (Hammermann/Stettes, 2015, 117).
Die Analysen mit dem Linked-Personnel-Panel signalisieren, dass die Personen im Homeoffice oder solche, die während der Freizeit dienstlich erreichbar sind, bei der Gestaltung der eigenen Aufgaben einen größere Handlungsspielraum haben (Arnold et al., 2015, 25 und 27). Sie bestätigen damit die Befunde auf Basis der BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung, wonach Beschäftigte auf vernetzten Internetarbeitsplätzen signifikant häufiger ihre eigene Arbeit planen und einteilen können, Einfluss nehmen auf die ihnen zugewiesene Arbeitsmenge, eigenständig über Pausenzeiten bestimmen und nicht auf Anweisungen angewiesen sind als nicht vernetzte Arbeitnehmer und solche, die nicht mit digitalen Technologien arbeiten (Hammermann/Stettes, 2015b, 130 und Tabelle 2-17). Dies impliziert, dass die Arbeitsbedingungen für Beschäftigte in einem digitalen Arbeitsumfeld adäquat gestaltet sind, um einen potenziell größeren Termindruck oder eine permanente Erreichbarkeit nicht als belastend zu empfinden.
So fühlen sich nur wenige Beschäftigte (20 Prozent und weniger) der häufig oder permanent erreichbaren Arbeitnehmer belastet (DGUV, 2012, 15 und 21). Auch Hammermann und Stettes (2015b, 131) finden, dass gerade einmal 4 Prozent der hiesigen Arbeitnehmer eine potentielle Dys-Balance zwischen hohem Termin- und Leistungsdruck und fehlenden Handlungsspielräumen aufweisen. Arnold et al. (2015, 28) zeigen zwar, dass aufgrund des Verschwimmens der Grenzen zwischen Privatleben und Arbeit bei der Nutzung des Homeoffices oder mobiler Endgeräte die Wahrscheinlichkeit von zeitlichen Konflikten zunimmt, allerdings das Engagement für und die Verbundenheit mit dem Betrieb ebenso höher sind. Dies gilt teilweise auch mit Blick auf die Arbeitszufriedenheit (bei Homeofficenutzern, die während der regulären Arbeits- bzw. Geschäftszeiten aktiv werden).
Wenn die Mehrheit der Beschäftigten nicht mobil arbeitet, ist dies vereinfacht formuliert auf drei Gründe zurückzuführen. Zwei Drittel der Beschäftigten, die nicht das Homeoffice nutzen, wün-schen sich eine strikte Trennung zwischen Beruf und Privatleben (BMAS, 2015b, 16). Für ebenso viele ist die eigene Tätigkeit nicht geeignet, weil zum Beispiel die Anwesenheit am betrieblichen Arbeitsplatz zwingend erforderlich, oder die Anwesenheit wird von den Führungskräften erwünscht. Dies signalisiert, dass die technischen Möglichkeiten der Digitalisierung zwar den Spielraum für eine räumliche und zeitliche Flexibilisierung erweitern. Ob dieser dann auch genutzt wird, hängt von den Vorstellungen und Präferenzen der Beteiligten ab sowie von Effizien-zaspekten bei der Organisation von Arbeit.
2.3.3 Zwischenfazit III
- Die vorhandene empirische Evidenz lässt noch keinen Schluss zu, wie sich Lohnstruktur und Verdienstperspektiven von bestimmten Beschäftigtengruppen entwickeln werden. Es liegt die Vermutung nahe, dass Höherqualifizierte auch in Zukunft günstigere Einkommensaussichten haben werden als Geringqualifizierte. Dies gilt in besonderem Maße für Beschäftigten in den MINT-Berufen.
Offen ist derzeit auch, ob im Zuge einer fortschreitenden Digitalisierung der Arbeitswelt flexible die Verbreitung leistungs-, erfolgs- und zielorientierter Vergütungsmodelle zunehmen wird. Der Dezentralisierungstrend bei Entscheidungsbefugnissen und -verantwortung begünstigt dies.
Implikation: Auch wenn die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Entwicklung von Löhnen und der Lohnstruktur noch nicht abgesehen werden kann, ist die Hypothese erlaubt, dass der Höherqualifizierungsbias des digitalen Wandels die Einkommensperspektiven und die Einkommensposition derer verbessert, die über die entsprechenden Kompetenzen verfügen. Dies ist allerdings eine Entwicklung, die bereits seit längerer Zeit am Arbeitsmarkt beobachtbar ist.
- Digitale Technologien erweitern die Spielräume zur räumlichen und zeitlichen Flexibilisierung der Arbeit. Sie bieten daher ein großes Potenzial, die Vereinbarkeit von privaten und beruflichen Anforderungen zu verbessern. Dies sehen auch die Beschäftigten in der Regel so.
Vor allem Führungskräfte sind häufig mit mobilen Endgeräten ausgestattet und im Homeoffice tätig. Bei ihnen spielen eher berufliche Motive eine Rolle als Vereinbarkeitsfragen, auch wenn mobiles Arbeiten auch diesen Chancen eröffnet, die Balance zwischen Beruf und Privatem zu verbessern.
Implikation: Der digitale Wandel birgt das große Potenzial, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern zu können. Die räumliche und zeitliche Flexibilisierung wird mehr als Chance und weniger als Bedrohung empfunden. Dies ist bei der Diskussion um potentiell gesundheitsgefährdende Belastungsfaktoren im Auge zu behalten. Es liegt die Vermutung nahe, dass es in Zukunft auf das konkrete Handeln der Beschäftigten und Führungskräfte auf der Arbeitsebene und damit deren Eigenverantwortung ankommt, wie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen individuellen und betrieblichen Flexibilisierungsansprüchen gefunden wird.
- Aussagen der Beschäftigten legen zwar nahe, dass Termin- und Leistungsdruck und Multitasking in einem digitalisierten Arbeitsumfeld relativ hoch sind. Allerdings weisen die Beschäftigten in einem solchen Umfeld auch über größere Handlungs- und Entscheidungsspielräume auf, die es ihnen erlauben, diesen höheren Anforderungen zu bewältigen. Dazu zählt auch die Möglichkeit, private und berufliche Anforderungen besser zu vereinbaren. Empirische Evidenz für eine stärkere psychische Belastungssituation findet sich derzeit nicht.
Gleiches gilt auch für die Frage, ob die Beschäftigten durch digitale Technologien für dienstliche Belange permanent in der Freizeit erreichbar sein müssen. Nur eine Minderheit der Beschäftigten wird zumindest mehrmals in der Woche kontaktiert. Und auch unter diesen empfindet nur eine kleine Gruppe dies als eine stark belastende Situation.
Implikation: Anders als häufig vorgebracht, birgt die Digitalisierung nach bisher vorliegender Evidenz kein besonderes Risikopotenzial für einen Anstieg psychischer Erkrankungen, auch wenn Termin- und Leistungsanforderungen vielerorts relativ hoch sind. Hauptgrund hierfür ist, dass die Beschäftigen auch mit den Ressourcen und Handlungsmöglichkeiten ausgestattet sind, gestiegene berufliche Anforderungen zu bewältigen. Es ist zu erwarten, dass an der Gemeinsamkeit von höheren Anforderungen und mehr Handlungsmöglichkeiten (bzw. Ressourcen) sich im Zuge einer fortschreitenden Digitalisierung nichts ändern wird, weil die Ausschöpfung der Potenziale digitaler Technologien setzt die Mobilisierung der individuellen Kompetenzen und Motivation voraus. Dieses gelingt am ehesten durch Delegation und Dezentralisierung.
- Die große Mehrheit der Beschäftigten arbeitet derzeit weder mobil noch (gelegentlich) im Homeoffice. Häufig scheitert dies an dem Wunsch der Beschäftigten nach einer strikten Trennung zwischen Arbeit und Privatleben. Auch die Eigenarten der beruflichen Tätigkeit, die die Anwesenheit am betrieblichen Arbeitsplatz erfordert, stehen vielfach einer Nutzung des Homeoffices im Wege. In anderen Fällen steht diese im Konflikt mit dem reibungslosen Ablauf des Arbeitsprozesses, wie ihn Führungskräfte für ihre Organisationseinheit etabliert haben und als zweckmäßig erachten.
Implikation: Die Präsenskultur lebt. Dies ist allerdings nicht per se negativ zu bewerten, weil sie sich vielerorts aus Sicht beider Seiten bewährt hat. Ob die Präsenskultur im Zuge der Digitalisierung an Bedeutung verlieren wird, bleibt abzuwarten. Dies hängt zum einen davon ab, wie sich die Präferenzen der Beschäftigten (auch mit Blick auf die Bereitschaft, flexiblere, erfolgs- bzw. leistungsabhängige Verdienste zu beziehen) entwickeln werden und in welchem Umfang eine aufgabenorientierte Flexibilisierung (i.e. Delegation und Dezentralisierung) mit einer räumlichen und zeitlichen Flexibilisierung im konkreten Fall sinnvollerweise einhergeht. Potentielle Veränderungen werden sich vor diesem Hintergrund deutlich zwischen Betrieben und selbst innerhalb von Betrieben zwischen einzelnen Organisationseinheiten unterscheiden.
3 Arbeitsmarktordnung im Zeichen des digitalen Wandels
Wenn sich die Arbeitsgesellschaft im Wandel befindet, ist die Diskussion darüber zielführend, ob die Institutionen noch adäquat ihre Funktionen erfüllen, die die Arbeitswelt ordnen, bzw. wie diese Institutionen gestaltet sein sollten, um den Wandel erfolgreich zu begleiten. Die Diskussion ist sachgerecht, weil der digitale Wandel gestaltbar ist. Im Fokus stehen dabei insbesondere die Institutionen, die im Grünbuch des BMAS (2015a, 77) adressiert werden und drei miteinander verwandte, gleichwohl unterschiedliche Teilaspekte der Arbeitswelt widerspiegeln.
Im Folgenden steht weniger im Vordergrund, ob die institutionelle Ausgestaltung des Arbeitsmarktes und der sozialen Sicherung in Deutschland generell als effektiv und effizient erachtet werden kann (vergleiche hierzu zum Beispiel Schäfer et al., 2014; Lesch et al., 2014; Enste, 2008; Niehues/Pimpertz, 2012; Pimpertz, 2013). Dies würde den Rahmen dieser Analyse sprengen. Vielmehr wird der Fokus darauf gelegt, ob sich aus dem digitalen Wandel ein Handlungsbedarf ergeben könnte. Dies impliziert zum einen, dass sich aktuell diskutierte oder potenzielle Reformvorschläge an den Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt orientieren sollten, die bereits heute im Zusammenhang mit der Digitalisierung empirisch zu beobachten sind oder sich zumindest relativ konkret abzeichnen.
3.1 Die Regulierung der materiellen Arbeitsbedingungen
Die vorangegangene Analyse hat gezeigt, dass zumindest derzeit keine unmittelbaren negativen Auswirkungen auf die Beschäftigungsperspektiven im Zuge einer fortschreitenden Digitalisierung zu erwarten sind (s. 2.1). Ähnliches gilt auch mit Blick auf die flexiblen Beschäftigungsformen. Ein systematischer Zusammenhang zwischen ihrer Verbreitung und dem digitalen Wandel ist derzeit nicht absehbar (s. 2.2). Vor diesem Hintergrund ist eine erste Schlussfolgerung erlaubt: Der arbeitsrechtliche Schutzschirm, den der gesetzliche Kündigungsschutz, das Befristungs- und Teilzeitgesetz sowie das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz über ein individuelles Arbeitsverhältnis spannen und mit dem ein potenziell vorhandenes Ungleichgewicht zwischen Arbeitgeber und einzelnem Beschäftigten ausgeglichen werden soll, wird seine Wirkung auch in einer digitalisierten Arbeitswelt nicht verlieren.
Dabei ist zu beachten, dass Kündigungsschutz und die rechtliche Ausgestaltung von befristeten Arbeitsverhältnissen und Zeitarbeit grundsätzlich als kommunizierende Röhren zu verstehen sind. Dem im internationalen Maßstab relativ rigide Schutz unbefristeter Beschäftigungsverhältnisse vor einer individuellen Kündigung oder bei Massenentlassungen, steht ein deutlich flexibleres Setting bei der befristeten Beschäftigung und der Zeitarbeit gegenüber (vgl. OECD, 2016). Befristungen und Zeitarbeit erhöhen als personalpolitische Instrumente die numerische externe Flexibilität der Unternehmen in einem volatilen Umfeld, die ein relativ rigider Bestandsschutz unbefristeter Beschäftigungsverhältnisse andernfalls einschränken würde (vgl. hierzu Flüter-Hoffmann/Stettes, 2011, Hardege/Schmitz, 2008). Zugleich fungieren sie für Nachwuchskräfte (insbesondere Befristungen) und vormals Arbeitslose (Zeitarbeit) als arbeitsmarktpolitisches Instrument der Integration in Beschäftigung (Schäfer/Schmidt, 2014).
Die Flexibilisierungsfunktion beider Beschäftigungsformen und damit deren Kompensationswirkung bleiben vor dem Hintergrund des digitalen Wandels wichtig. So ist erstens nicht zu erwarten, dass die Unsicherheit für die Unternehmen im Zuge der Digitalisierung abnimmt. Ob und in welchem Umfang sich neue Geschäftsmodelle durchsetzen, etablierte hingegen vom Markt gedrängt werden, bleibt ungewiss. Damit ist auch die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen Arbeitsplätze ungewiss. Flexible Beschäftigungsformen eröffnen den Betrieben die Möglichkeit, die dazugehörigen Arbeitsverhältnisse unabhängig davon aufzubauen oder zu erhalten, ob sie sich mittel- bis langfristig als tragfähig herausstellen. Sie leisten damit einen Beitrag zur Reduzierung von Unsicherheiten, wodurch zugleich der Anreiz erhöht wird, zusätzliche unbefristete Vollzeitbeschäftigungsverhältnisse zu schaffen. Gesamtwirtschaftlich ist auch seit Längerem ein Anstieg des unbefristeten Vollzeitbeschäftigungsverhältnisses zu beobachten (Statistisches Bundesamt, 2016). Beide Beschäftigungsformen ermöglichen darüber hinaus auch den Rückgriff auf Know-how, das lediglich temporär für eine längere Einführungsphase (z. B. die Integration digitaler Informations- und Kommunikationstechnologien und damit korrespondierender Prozesse) benötigt wird, ohne in den Regelungsbereich des relativ rigiden gesetzlichen Kündigungsschutzes zu geraten.
Eine Reform des gesetzlichen Kündigungsschutzes für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse hierzulande erscheint derzeit polit-ökonomisch nicht durchsetzbar. Sie ist vor dem Hintergrund der Möglichkeit, auf befristete Beschäftigung und Zeitarbeit zurückzugreifen auch nicht zwingend erforderlich, um die Anpassungsflexibilität der Unternehmen zu gewährleisten. Allerdings sind vor diesem Hintergrund Überlegungen, die Möglichkeiten der sachgrundlosen Befristung einzuschränken (z. B. vonseiten der Bundestagsfraktion DIE LINKE, Deutscher Bundestag, 2015b), und das im Koalitionsvertrag avisierte und derzeit im Entwurfsstatus diskutierte Gesetzesvorhaben zur Re-Regulierung der Zeitarbeit – insbesondere die Einführung einer Höchstüberlassungsdauer und eines gesetzlichen Equal-Pay-Gebots – negativ zu bewerten (vgl. hierzu detailliert Schäfer/Stettes, 2015). Sie bergen zudem die Gefahr, Arbeitslosen und Nichterwerbstätigen nicht nur den Einstieg in Arbeit zu verwehren, sondern auch die Möglichkeit zu nehmen, ihre Kompetenzen im Arbeitsprozess (weiter) zu entwickeln und gegebenenfalls durch den sukzessiven Erwerb von Teilqualifikationen einen beruflichen Abschluss zu erlangen.
Die Auswirkungen des digitalen Wandels auf die Lohnstruktur und das Lohnniveau sind derzeit ebenfalls noch nicht absehbar (s. 2.3.1). Mit der Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns zum 1. Januar 2015 ist hierzulande eine allgemeine Lohnuntergrenze implementiert worden, deren Geltungsbereich im Zuge einer fortschreitenden Digitalisierung nicht kleiner werden dürfte. Abhängige Beschäftigung wird nicht durch selbständige Erwerbsarbeit verdrängt. Für diese Hypothese spricht, dass die Anzahl der Solo-Selbständigen seit mehreren Jahren konstant geblieben ist, und es existieren keine Anhaltspunkte dafür, dass sie in Zukunft ansteigen wird (s. 2.2.3). Mit Blick auf die von Mindestlöhnen betroffene abhängige Beschäftigung ist zumindest in der kurzen Frist zu erwarten, dass die Lohnstruktur eher komprimiert wird.
Dies hat auch Konsequenzen für Lohneffekte, die sich in Zukunft systematisch im Zusammenhang mit dem digitalen Wandel ergeben. So können die nominalen Löhne bei den Beschäftigten, die potenziell negativ von der Digitalisierung betroffen sein könnten, nur bis zur gesetzlichen Lohnuntergrenze sinken. Inwieweit sich in mittlerer bis langer Frist die relativen Löhne zwischen potenziell positiv und negativ betroffenen Beschäftigtengruppen dann weiter ausdifferenzieren, weil Personen aus Hochlohngruppen versuchen, den alten Lohnabstand wieder herzustellen, muss offen bleiben (vgl. hierzu beispielsweise Lesch/Bennet, 2010).
Multivariate Auswertungen des IW-Personalpanels signalisieren, dass zwischen der Bindung an einen Tarifvertrag und dem Digitalisierungsgrad des Betriebes keine signifikante Korrelation existiert. Das gilt gleichermaßen für Flächentarifverträge wie für Firmentarifverträge. Auch die freiwillige Orientierung eines Betriebes an einen Tarifvertrag steht in keinem signifikanten Zusammenhang mit dem Grad der Digitalisierung von Geschäfts- und Arbeitsprozessen. Vor diesem Hintergrund besteht derzeit auch kein Handlungsbedarf für eine Modifizierung des Tarifrechts. Die Gestaltungskraft der Tarifvertragsparteien bei der Aushandlung materieller Arbeits-bedingungen hängt auch in einer digitalisierten Arbeitswelt von der Attraktivität des Tarifvertrages und damit von der Eignung und Passgenauigkeit der tarifvertraglichen Standards an die konkreten betriebsspezifischen Erfordernisse ab. Dies gilt für bis dahin nicht-tarifgebundene Unternehmen, die einen Beitritt zu einem Arbeitgeberverband in Erwägung ziehen, gleichermaßen wie für tarifgebundene Betriebe, die einen Austritt aus bzw. Verbleib im Tarifverband erwägen.
Ähnliches gilt für die Arbeitnehmerseite. Das abhängige Beschäftigungsverhältnis wird vor dem Hintergrund der vorliegenden empirischen Evidenz nicht an Bedeutung verlieren. Die Attraktivität der Gewerkschaften für die Beschäftigten mit heterogenen und im Zeitablauf wechselnden Bedürfnissen wird daher davon abhängen, ob es ihnen gelingt, differenzierte Tarifstandards auszuhandeln, um potenzielle Mitglieder zum Eintritt oder aktuelle Mitglieder zum Verbleib zu bewegen.
Sowohl im Grünbuch Arbeit 4.0 des BMAS (2015a, 79) als auch in einem Positionspapier "Arbeiten 4.0" der SPD-Bundestagsfraktion (2016, 3) wird betont, dass der Qualifizierung der Beschäftigten eine zunehmend wichtigere Rolle zukommen sollte, um die individuelle Beschäftigungs- und Anpassungsfähigkeit an den digitalen Wandel zu verbessern und Dequalifizierungsprozessen entgegenzuwirken. Die Vermeidung von Arbeitslosigkeit und damit der Präventionsgedanke sollen stärker in den Fokus der Arbeitsförderung gerückt werden. Dabei wird vorgeschlagen, dass die Bundesagentur für Arbeit zu einer Bundesagentur für Arbeit und Qualifizierung umgebaut wird, die im Rahmen der Arbeitslosenversicherung helfen soll, klar formulierte individuelle Ansprüche auf Aus- und Weiterbildung umzusetzen (SPD-Bundestagsfraktion, 2016, 3).
Derartige Vorschläge folgen dem für sich zunächst als sinnvoll zu erachtenden Leitgedanken, dass es besser ist, die einzelnen Beschäftigten zu befähigen, sich an Veränderungen anzupassen, als der Versuch, bestehende Arbeitsplätze mit Subventionen und anderen politischen Interventionen zu erhalten, die unmittelbar oder mittelbar im Zuge einer fortschreitenden Digitalisierung auf den Prüfstand geraten. Sie korrespondieren im Grundsatz auch mit der Erwartung, dass die Kompetenzanforderungen tendenziell zunehmen. Gleichwohl sind die genannten Vorschläge, die Verantwortung für Fragen der Aus- und Weiterbildung und damit den Aufgabenbereich der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Arbeitsförderung zu erweitern, eher zurückhaltend zu bewerten.
Erstens bleibt bei einer Qualifizierungsberatung durch die Arbeitsagenturen offen, ob die Berater vor Ort das erforderliche Wissen aufweisen, welche konkreten Kompetenzen in der Zukunft auf einem bestimmten Arbeitsplatz in einem bestimmten Betrieb erforderlich sind und welche Formen der Qualifizierung bzw. welche Anbieter von Qualifizierungsmaßnahmen geeignet sind, diese Kompetenzen zu vermitteln oder deren Entwicklung zu unterstützen. In der Regel ist davon auszugehen, dass die Beschäftigten und/oder ihr Arbeitgeber im konkreten Betrieb darüber einen besseren Kenntnisstand aufweisen als die externen Berater der Arbeitsagenturen. Nach einer erfolgten Erstausbildung sollten die Entwicklung und der Aufbau von Wissen und Fähigkeiten im weiteren Verlauf des Erwerbslebens daher möglichst arbeitsplatznah erfolgen.
Eng damit verbunden ist ein zweiter Aspekt. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels werden sich vor allem alternde Belegschaften den Herausforderungen einer digitalen Arbeitswelt und den damit veränderten Kompetenzanforderungen stellen müssen. Kompetenzerhalt und -entwicklung müssen die Besonderheiten des Lernens in späteren Lebensphasen im Auge behalten. So hängt die Lernfähigkeit maßgeblich von den Merkmalen der bisherigen Erwerbsbiografie ab und wird zudem von der Lernform beeinflusst (Stettes, 2010a). Empirische Studien signalisieren, dass für ältere Beschäftigte zum Beispiel arbeitsplatznahes Lernen effektiver und effizienter ist als formale Weiterbildungsseminare (z. B. Göbel/Zwick, 2009; Zwick, 2011).
Daher mag es wenig überraschen, dass stark digitalisierte Unternehmen dem informellen Wissensaufbau durch individuelle und organisatorische Personalentwicklungsmaßnahmen eine besonders große Aufmerksamkeit widmen (Hammermann/Stettes, 2016). Sie gestalten signifikant häufiger als weniger stark digitalisierte Betriebe die Arbeitsumgebung lernförderlich und implementieren häufiger altersgemischte Teams sowie Wissenstransfersysteme, damit die Beschäftigten in einem digitalisierten Umfeld das erforderliche berufliche und betriebliche Erfahrungswissen aufbauen, erhalten, weiterentwickeln und auch an andere weitergeben können. Digitalisierte Unternehmen betreiben zudem häufiger die systematische Analyse von Kompetenzprofilen und beruflichen Ambitionen, wodurch die Mitarbeiter leichter für Veränderungen gewonnen und zu deren Umsetzung befähigt werden. Die empirischen Befunde zu den Personalentwicklungs- und Weiterbildungsaktivitäten digitalisierter Betriebe signalisieren zugleich, dass derzeit keine Handlungsnotwendigkeit existiert, die Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit stärker auf die (präventive) Qualifizierung der Beschäftigten auszurichten. Die Unternehmen sind sich ihrer eigenen Verantwortung bewusst und sind eher in der Lage, ihre Anforderungen mit den Präferenzen und bereits vorhandenen Fähigkeiten der Mitarbeiter effizient auszutarieren, sodass sich Humankapitalinvestitionen für beide Seiten lohnen.
Eine schwerpunktmäßige Verlagerung der Verantwortung für die Qualifizierung von Beschäftigten von dem Betrieb und dem einzelnen Arbeitnehmer auf die Bundesagentur für Arbeit erhöht viertens das Risiko von Fehlqualifizierungen und damit Fehlinvestitionen. Dies betrifft nicht nur die Fragen, welche konkreten Kompetenzen aufgebaut werden sollen und welche Qualifizierungsform dann geeignet ist, sondern auch die Fragen, wer die Kosten für die Maßnahme zu tragen hat und wem die späteren Erträge der Humankapitalinvestition zufallen. Bei einer Abwägung auf betrieblicher Ebene wird es in der Regel zu einer Aufteilung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer kommen, die die unmittelbare und mittelbare Verwertbarkeit im Betrieb sachgerecht berücksichtigt. Ein stärkeres Gewicht der Arbeitsförderung bei der Weiterbildung von Beschäftigten im Rahmen der Arbeitslosenversicherung könnte die effiziente Balance von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressen verzerren. Dies gilt insbesondere dann, wenn aus einer Kann-Leistung ein rechtlicher Anspruch des Beschäftigten gegenüber seinem Arbeitgeber wird. Im ungünstigsten Fall werden dann Kompetenzen erworben bzw. Qualifizierungsmaßnahmen durchgeführt, die die Beschäftigungs- und Anpassungsfähigkeit einer Person nicht erhöhen, während zugleich die Weiterbildungsausgaben im Rahmen der Arbeitsförderung und damit die Beitragssätze der Arbeitslosenversicherung ansteigen. Dieser Aspekt ist auch bei der Förderung von Arbeitslosen zu beachten.
3.2 Ausgestaltung des Sozialstaates
Wer einen fundamentalen Wandel erwartet, wird auch die Frage stellen, ob im Zeichen der Digitalisierung auch eine Neujustierung der sozialen Sicherung erforderlich ist, um Lebensrisiken abzumildern oder Armut während des Erwerbslebens und im Rentenalter vorzubeugen bzw. eine angemessene Absicherung im Alter zu gewährleisten. So wird zum Beispiel mit Blick auf die Rente eine Erwerbstätigen- bzw. Bürgerversicherung als Denkoption benannt (BMAS, 2015, 80 und SPD - Bundestagsfraktion, 2016, 8). Selbst ein bedingungsloses Grundeinkommen erfährt im Zusammenhang mit einer sozialen Grundsicherung eine Renaissance – ebenfalls zumindest als Denkalternative (z. B. Höttges, 2016). Gegen eine vorausschauende sozialpolitische Diskussion ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Allerdings sollte sie ebenso wie die Diskussion um den Ordnungsrahmen auf dem Arbeitsmarkt auf Basis der derzeit vorliegenden empirischen Evidenz erfolgen.
Aus dieser Perspektive spricht wenig für einen konkreten Handlungsdruck, dem die Politik nachkommen sollte. So sind derzeit weder negative Beschäftigungsfolgen der Digitalisierung noch potenziell negativ eine Verbreitung bestimmter Beschäftigungsformen zu erkennen, die negativ zu beurteilen. Auch ungünstige Entwicklungen bei den materiellen Arbeitsbedingungen sind derzeit nicht absehbar. Zusätzliche Belastungen für die Systeme der sozialen Sicherung sind von der Digitalisierung vor diesem Hintergrund für die kommenden Jahre zunächst nicht zu erwarten.
Dies gilt insbesondere mit Blick auf die Frage, ob durch neue Formen der Selbständigkeit die beitragsfinanzierten sozialen Sicherungssysteme erodieren könnten und aufgrund unzureichender Einkommensperspektiven der betroffenen Individuen der Sozialstaat an anderer Stelle gefordert ist, ein materielles Mindestsicherungsniveau steuerfinanziert bereitzustellen. Für eine Versicherungspflicht von Selbständigen, um dem Problem potenzieller Altersarmut vorzubeugen, liefert die Digitalisierung unabhängig von der Ausgestaltungsform der Altersabsicherung (z. B. frei wählbare Mindestabsicherung oder Pflichtmitgliedschaft in der gesetzlichen Rentenversicherung) keine zusätzliche Argumentationshilfe (s. 2.2.3).
Für abhängig Beschäftigte existieren mit dem Mindestlohn und der Arbeitslosenversicherung zwei institutionelle Regelungen auf dem Arbeitsmarkt, die die materiellen Risiken in Form von Verdiensteinbußen in Arbeit und durch temporäre Arbeitslosigkeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer begrenzen. Wo diese nicht ausreichen sollten, leistet der Bezug von (ergänzendem) Arbeitslosengeld-II die Gewähr, dass ein Mindestabsicherungsniveau realisiert wird. Dies gilt auch im Zeichen einer digitalisierten Wirtschaft und Arbeitswelt. Tabelle 3-2: Ergebniszusammenfassung - Soziale Sicherung ausgewählte Sicherungsbereiche
3.3 Die Regulierung der immateriellen Arbeitsbedingungen
Betriebsräte sind die Institutionen, die gestützt auf einer gesetzlichen Basis maßgeblich die immateriellen Arbeitsbedingungen auf der betrieblichen Ebene regeln können. Materielle Gesichtspunkte wie Länge der Arbeitszeit und Löhne sind hingegen gemäß der betrieblichen Regelungssperre des § 77 Abs. 3 BetrVG der Domäne der betrieblichen Interessenvertreter entzogen. Zugleich sind sie für die Einhaltung tarifvertraglicher und gesetzlicher Regelungen zuständig. Befürchtungen, dass der betrieblichen Mitbestimmung in einer digitalisierten Wirtschaft und Arbeitswelt durch neue Formen der Zusammenarbeit wie Click- oder Crowdworking der Boden entzogen werden könnte (z. B. SPD-Bundestagsfraktion, 2016, 4), erscheinen vor dem Hintergrund der empirischen Evidenz zu den Solo-Selbständigen und Crowdworking (s. 2.2.3) aus heutiger Perspektive nicht berechtigt. Auch eine verstärkte potenzielle Arbeitsteilung zwischen Betrieben im Zuge einer fortschreitenden Digitalisierung ist keine Gefahr für den Geltungsbereich der Betriebsverfassung. Aktivitäten in einem Netzwerk und Kooperationen lassen die Möglichkeit zur Bildung eines Betriebsrates und zum Agieren im Interesse der Belegschaften unberührt.
Empirische Untersuchungen signalisieren erstens, dass der Verbreitungsgrad von Betriebsräten seit mehreren Jahren im Großen und Ganzen konstant ist (zuletzt in 2014: 9 Prozent, vgl. Ellguth/Kohaut, 2015; Stettes, 2007). Die Neugründungsquote ist relativ niedrig (Stettes, 2011, 24) und die Wahrscheinlichkeit einer Gründung steigt mit zunehmender Unsicherheit der Beschäftigten, wie sich die Arbeitgeberseite in Zukunft verhalten wird. Zudem unterscheiden sich die Merkmale von Betrieben und Belegschaften mit einem Betriebsrat deutlich von den Merkmalen in den Betrieben, in denen eine alternative Interessenvertretung oder kein Betriebsrat existiert (z. B. Stettes, 2010b, 205). Die Befunde deuten darauf hin, dass Betriebsräte dort gebildet werden, wo die Beschäftigten ein relativ hohes Schutzbedürfnis aufweisen. Empirische Auswertungen mit dem IW-Personalpanel legen nahe, dass der Digitalisierungsgrad eines Unternehmens auf dieses Kalkül keinen Einfluss ausübt. Dieser korreliert weder mit der Existenz eines Betriebsrats noch mit der einer alternativen Interessenvertretung.
Eine Stärkung der betrieblichen Mitbestimmung insbesondere in Fragen der langfristigen beruflichen Qualifizierung und der Arbeitsorganisation, wie sie von mancher Seite vorgeschlagen wird (z. B. SPD-Bundestagsfraktion, 2016, 7f), ist nicht erforderlich. Bereits heute gewährt das Betriebsverfassungsgesetz den Betriebsräten umfangreiche Informations-, Beratungs- und Mitspracherechte, bei denen teilweise Zweifel angebracht sind, ob diese aus Effizienzgründen überhaupt gerechtfertigt sind (Stettes, 2007, 33 ff.). Dieser Vorbehalt betrifft vor allem die Rechte des Betriebsrats in Fragen der beruflichen Qualifizierung, die im Zuge einer fortschreitenden Digitalisierung eine wichtige Funktion zur Stärkung der Anpassungsfähigkeit und -bereitschaft einnehmen. So besteht ohnehin schon das Risiko, dass das effiziente Investitionskalkül in der Weiterbildung und Kompetenzentwicklung durch die Intervention eines Betriebsrats verzerrt werden könnte. Eine Ausweitung der Mitspracherechte würde dieses Risiko noch erhöhen. Eine Stärkung der Mitbestimmungsrechte in anderen arbeitsorganisatorischen, personellen und wirtschaftlichen Angelegenheiten würde die austarierte Balance von effizienten Mitspracherechten und unternehmerischer Freiheit ebenfalls gefährden. Eine effizienzorientierte Reform des Betriebsverfassungsgesetzes, die auch mit einer Schwächung von Mitspracherechten für Betriebsräte in manchen personalpolitischen Handlungsfeldern einhergehen würde (vgl. hierzu z. B. Stettes, 2004, 236 ff.), erscheint politökonomisch analog zum Kündigungsschutz ebenfalls nicht realisierbar. Ein Handlungsbedarf, Mitbestimmungsrechte zu stärken, existiert allerdings im digitalen Wandel auch nicht.
Die gesetzliche Regulierung von Teilzeit rückt angesichts der Überlegungen zur neuen Vereinbarkeit und damit über gesetzliche Ansprüche auf Wahlarbeitszeiten oder einen Rückkehranspruch von Teilzeit auf Vollzeit in den Blickpunkt (vgl. z. B. SPD-Bundestagsfraktion, 2016, 9). Die empirische Analyse legt allerdings zum einen nahe, dass der Wunsch, in Teilzeit zu arbeiten, voraussichtlich wenig von der Digitalisierung der Arbeitswelt beeinflusst wird (s. 2.2.2). Zum anderen erhöhen digitale Technologien eher den Spielraum, die Vereinbarkeit familiärer und beruflicher Anforderungen auch bei einer Vollzeitbeschäftigung zu verbessern – zum Vorteil sowohl der betroffenen Mitarbeiter als auch der Betriebe (s. 2.3.2). Vor dem Hintergrund, dass im Zuge einer fortschreitenden Digitalisierung Arbeitsaufgaben und Verantwortung dezentralisiert und an den einzelnen Mitarbeiter delegiert werden könnten, ist aus Sicht der Unternehmen sinnvoll, bei Fragen der Arbeitszeitgestaltung private Interessen ihrer Arbeitnehmer im Auge zu behalten. Es ist daher fraglich, ob im Zuge des digitalen Wandels ein Handlungsbedarf existiert, weitere gesetzliche Bestimmungen einzuführen, mit denen die Beschäftigten auch gegen berechtigte Interessen ihre Arbeitszeitwünsche durchsetzen können.
Dies gilt gleichermaßen für Überlegungen, wie sie zuletzt von Bündnis90/Die Grünen ins Spiel gebracht wurden, ähnlich wie in den Niederlanden einen gesetzlichen Anspruch auf mobiles Arbeiten bzw. Nutzung des Homeoffices zu implementieren (vgl. Deutscher Bundestag, 2016). Dort, wo es aus Sicht der Beschäftigten und des Unternehmens gleichermaßen Sinn macht, werden den Beschäftigten die Möglichkeiten eingeräumt, räumlich und zeitlich flexibel zu arbeiten. Ein gesetzlicher Anspruch birgt erstens das große Risiko, dass die Effizienz der Arbeitsprozesse beeinträchtigt wird, wenn die Ablehnungsgründe vor dem Hintergrund des betrieblichen Kontextes sachgemäß sind (z. B. der Wunsch der Führungskräfte nach Präsens der Mitarbeiter am betrieblichen Arbeitsplatz), aber von externer Seite (z. B. Arbeitsgerichte) nicht als berechtigte Ablehnungsgründe akzeptiert werden. Zweitens würde mit Blick auf die ordnungsgemäße Gestaltung von Arbeitsplätzen außerhalb des Betriebs und den Zugang des Arbeitgebers zu den privaten Räumlichkeiten der Beschäftigten zunehmend die Frage aufgeworfen, wie der Arbeitgeber seiner Fürsorgeverantwortung für den Mitarbeiter dann gerecht werden kann, ohne in den grundgesetzlich geschützte Privatsphäre einzugreifen.
Derzeit spricht auch wenig für weitere Eingriffe in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, selbst wenn digitale Technologien theoretisch eine 24-stündige Erreichbarkeit der Beschäftigten herstellen und eine Überforderung der Beschäftigten verursachen könnten, indem sie permanente Informationen und Arbeitsaufgaben übermitteln. Es ist zunächst theoretisch fraglich, ob eine Ausschöpfung dieses technischen Potenzials auch aus Effizienzgründen Sinn ergibt. Denn die Bereitschaft und die Kompetenzen der Beschäftigten sind die Schlüsselressourcen einer erfolgreichen unternehmerischen Anpassung an die Herausforderungen des digitalen Wandels. Dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und potenzieller Fachkräfteengpässe. Aus Effizienzgründen werden Unternehmen daher zusammen mit den Beschäftigten Wege eruieren, eine sachgerechte Balance zu finden, die die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter nachhaltig stärkt. Das freiwillige Engagement der Betriebe in Sachen Gesundheitsmanagement ist ein Signal dafür, dass sich die Unternehmen der Bedeutung des Erhalts der Beschäftigungsfähigkeit bewusst sind (vgl. hierzu Hammermann/Stettes, 2013, 105; IW Köln, 2016).
Da Arbeitnehmer ein potenziell höheres Aufgabenvolumen und einen stärkeren Termindruck durch unterschiedliche organisatorische und individuelle Ressourcen ausgleichen können (s. 2.3.2), ist der optimistische Schluss erlaubt, dass auch in dieser Hinsicht nach derzeitiger Lage die Chancen digitaler Technologien potenzielle Risiken übersteigen. Mit der Gefährdungsbeurteilung ist im Arbeitsschutzgesetz zudem ein Instrument implementiert, mit dem Unternehmen die Merkmale von Arbeitsplätze daraufhin überprüfen müssen, ob sie negative psychische Beanspruchungen zur Folge haben, die gesundheitliche Negativfolgen auslösen könnten. Weiterer Handlungsbedarf besteht daher vorerst nicht.
Digitale Technologien weisen zudem das Potenzial auf, umfangreiche personenbezogene Daten im Arbeitsprozess zu sammeln und im Verbund mit anderen Datenquellen auswerten, sodass Aufschluss über das individuelle Verhalten, Leistungsvermögen, Leistungsbereitschaft und Gesundheit gewonnen werden kann (Stichwort big data). Dieses Potenzial könnte dann für eine verstärkte Kontrolle der Beschäftigten genutzt werden oder zur Ermittlung von Wahrscheinlichkeiten, wie sich die Beschäftigungsfähigkeit des einzelnen Mitarbeiters im Zeitablauf entwickeln wird. Im Extremfall könnte die Verknüpfung und Auswertung der vernetzten Daten nachteilige Folgen für Beschäftigungs-, Aufstiegs- und Verdienstperspektiven nach sich ziehen. Konkreter gesetzlicher Handlungsbedarf besteht trotz dieses Szenarios derzeit aber nicht. Zum einen weist das Betriebsverfassungsgesetz dem Betriebsrat umfangreiche Mitbestimmungsrechte in Fragen des (individuellen) Datenschutzes zu. Gleiches gilt für die Datenschutzbeauftragten. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass bei der Einführung und dem Einsatz digitaler Technologien Vorbehalten und Änderungswünschen Rechnung getragen werden kann.
Ob Unternehmen das Potenzial zur Leistungs- und Verhaltenskontrolle überhaupt nutzen werden, ist fraglich, denn sie könnten damit die Effizienz der eigenen Arbeitsorganisation gefährden. Wenn Arbeit selbständiger durch die Beschäftigten organisiert wird, sie eine größere Verantwortung tragen sowie bessere Informationen und Kompetenzen für die erforderlichen Entscheidungen aufweisen, funktioniert eine derartige Dezentralisierung und Delegation nur auf der Grundlage gegenseitigen Vertrauens. Eine verstärkte Leistungs- oder Verhaltenskontrolle durch die Ausnutzung vernetzter Informationsquellen ohne Zustimmung der betroffenen Mitarbeiter würde von diesen als Vertrauensbruch gewertet werden. Dann läuft das Unternehmen Gefahr, die erforderliche Bereitschaft der Beschäftigten zu verlieren, ihre Kompetenzen so einzusetzen, dass schnell und angemessen auf Veränderungen im Umfeld und im Arbeitskontext reagiert wird oder innovative, kreative Lösungen für Probleme und Kundenwünsche gefunden werden.
4 Fazit
Die vorangegangen Analyse konnte zeigen, dass sich derzeit noch keine gravierenden Veränderungen in der Arbeitswelt durch die zunehmende Verbreitung und Vernetzung von modernen Informations- und Kommunikationstechnologien abzeichnen. Die teilweise hysterische öffentliche Diskussion um potenziell negative Folgen der Digitalisierung auf Beschäftigung und Beschäftigte steht in einem markanten Kontrast zur derzeitigen empirischen Realität. Für die Politik sollte allerdings die vorliegende empirische Evidenz handlungsleitend sein, nicht ein diffuses Ungemach, dass sich aus im Extremfall Untergangsprophezeiungen einer noch nicht absehbaren Zukunft speist.
Um eine angemessene Antwort auf die gegenwärtigen und künftigen Herausforderungen in der Arbeitswelt zu finden, sollte die Politik sich im Zusammenhang mit der Digitalisierung die Fragen stellen, warum sich die künftige Entwicklung von den bisherigen Erfahrungen abkoppeln sollte und welche Anhaltspunkte sie zu einem solchen Schluss führen kann. Sie könnte dann auf diese Weise identifizieren, welche spezifischen Interessen einen Handlungsbedarf dort reklamieren, wo eigentlich keiner besteht und die Digitalisierung unsachgemäß lediglich einem bereits bestehenden Standpunkt Geltung verschaffen soll.
Für verfrühten politischen Aktionismus besteht keine Notwendigkeit. Gestaltungswille ist dann gefordert, wenn sich in Zukunft politisch und gesellschaftlich ungewünschte Folgewirkungen einer fortschreitenden Digitalisierung ergeben sollten, die politischen Handlungsdruck erzeugen könnten. Diese Auswirkungen vollziehen sich jedoch nicht über Nacht und werden Schritt für Schritt erkennbar sein. Politik verliert daher auch in einer digitalisierten Wirtschaft keineswegs die Gestaltungsmacht über den ordnungspolitischen Rahmen auf dem Arbeitsmarkt und in der sozialen Sicherung.
5 Literatur
Anger, Christina / Koppel, Oliver / Plünnecke, Axel,
MINT-Frühjahrsreport 2015 - Regionale Herausforderungen und Chancen der Zuwanderung,
Köln 2015
Arnold, Daniel / Steffes, Susanne / Wolter, Stefanie,
Mobiles und entgrenztes Arbeiten, BMAS-Forschungsbericht 460,
Berlin 2015
Berthold, Norbert / Stettes, Oliver,
Die Gewinnbeteiligung - Wundermittel im organisatorischen und strukturellen Wandel?, in Jahrbuch für Wirtschaftswissenschaften / Review of economics, Bd. 52.2001, 3, 287-315
2002
Bertschek, Irene / Ohnemus, Jörg / Viete, Steffen,
Befragung zum sozioökonomischen Hintergrund und zu den Motiven von Crowdworkern, Kurzexpertise für das BMAS,
Mannheim 2015
Bonin, Holger / Gregory, Terry / Zierahn, Ulrich
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, Übertragung der Studie von Frey/Osborne (2013) auf Deutschland, Endbericht Kurzexpertise, Nr. 57,
Mannheim 2015
Bundesagentur für Arbeit – BA,
Arbeitsmarkt in Zahlen Beschäftigungsstatistik - Sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigte nach der ausgeübten Tätigkeit der KldB 2010 Deutschland, diverse Jahrgänge,
Nürnberg
Bundesagentur für Arbeit – BA,
Arbeitsmarkt in Zahlen Beschäftigungsstatistik - Sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen der WZ 2008 in Deutschland - Zeitreihe -, diverse Jahrgänge,
Nürnberg
Bundesagentur für Arbeit – BA, 2015 und 2016,
Arbeitsmarkt in Zahlen Beschäftigungsstatistik - Leiharbeitnehmer und Verleihbetriebe – Zeitreihe ab 1973 – Deutschland und Zeitreihe ab 2013 – Deutschland (revidierte Daten 2013 und 2014),
Nürnberg
Bundesagentur für Arbeit – BA,
Arbeitsmarkt in Zahlen Beschäftigungsstatistik - Leiharbeitnehmer und Verleihbetriebe - 1. Halbjahr 2015 (Revidierte Daten 2013 und 2014),
Nürnberg
Bundesministerium für Arbeit und Soziales – BMAS,
Arbeiten 4.0 – Arbeit weiter denken, Grünbuch,
Berlin 2015
Bundesministerium für Arbeit und Soziales – BMAS,
Monitor – Mobiles und entgrenztes Arbeiten,
Berlin 2015
Bundesministerium für Arbeit und Soziales – BMAS,
Monitor - Digitalisierung am Arbeitsplatz,
Berlin 2016
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie – BMWi,
Monitoring Report Digitale Wirtschaft 2014 – Innovationstreiber IKT,
Bonn 2014
DAK Gesundheit - DAK,
DAK-Gesundheitsreport 2013,
Hamburg 2013
Dengler, Katharina / Matthes, Britta,
Folgen der Digitalisierung für die Arbeitswelt – Substituierbarkeitspotenziale von Berufen in Deutschland, IAB-Forschungsbericht 11/2015,
Nürnberg 2015
Deutscher Bundestag,
Aktuelle Daten zur befristeten Beschäftigung, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Jutta Krellmann, Klaus Ernst, Susanna Karawanskij, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE, Drucksache 18/5800.
Berlin 2015
Deutscher Bundestag,
Junge Beschäftigte vor prekärer Arbeit schützen – Antrag der Abgeordneten Klaus Ernst, Jutta Krellmann, Sabine Zimmermann, Matthias W. Birkwald, Susanna Karawanskij, Thomas Lutze, Thomas Nord, Richard Pitterle, Michael Schlecht, Azize Tank, Dr. Axel Troost, Dr. Sahra Wagenknecht, und der Fraktion Die Linke, Drucksache 18/6362,
Berlin 2015
Deutscher Bundestag,
Andreae fragt nach einem Recht auf Homeoffice,
2016
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung - DGUV,
Ständige Erreichbarkeit: Wie belastet sind wir? – Ursachen und Folgen ständiger Erreichbarkeit, IAG Report 1/2012,
2012
Eichhorst, Werner / Arni, Patrick / Buhlmann, Florian / Isphording, Ingo / Tobsch, Verena,
Wandel der Beschäftigung – Polarisierungstendenzen auf dem deutschen Arbeitsmarkt, IZA Research Report No. 68,
Bonn 2015
Ellguth, Peter / Kohaut, Susanne,
Tarifbindung und betriebliche Interessenvertretung: Ergebnisse aus dem IAB-Betriebspanel 2014, in: WSI-Mitteilungen 4/2015, S. 290–297
2015
Enste, Dominik,
Bedingungsloses Grundeinkommen – Traum oder Albtraum für die Soziale Marktwirtschaft, RHI-Diskussion Nr. 5,
München 2008
Flake, Regina / Werner, Dirk / Zibrowius, Michael, Karrierefaktor berufliche Fortbildung - Eine empirische Untersuchung der Einkommens- und Arbeitsmarktperspektiven von Fachkräften mit Fortbildungsabschluss im Vergleich zu Akademikern, Studie für die DIHK-Gesellschaft für berufliche Bildung – Organisation zur Förderung der IHK-Weiterbildung mbH,
Köln 2016
Flüter-Hoffmann, Christiane / Stettes, Oliver,
Neue Balance zwischen betrieblicher Flexibilität und Stabilität – Ergebniss einer repräsentativen IW-Befragung, in: IW-Trends, Jg. 38, Nr. 1, 3-18
2011
Frey, Carl B. / Osborne, Michael,
The future of employment: how susceptible are jobs to computerization?, University of Oxford
2013
Gehrke, Birgit / Cordes, Alexander / John, Katrin / Frietsch, Rainer / Michels, Carolin / Neuhäusler, Peter / Pohlmann, Tim / Ohnemus, Jörg / Rammer, Christian,
Informations- und Kommunikationstechnologien in Deutschland und im internationalen Vergleich – ausgewählte Innovationsindikatoren, in: Expertenkommission Forschung und Innovation (Hrsg.), Studien zum deutschen Innovationssystem, Nr. 11,
Berlin 2014
Göbel, Christian / Zwick, Thomas,
Age and Productivity. Evidence from Linked Employer Employee Data, ZEW Discussion Paper, No. 09-020,
Mannheim 2009
Graetz, Georg / Michaels, Guy,
Robots at Work, IZA Discussion Paper, Nr. 8938
2015
Hammermann, Andrea / Stettes,
Beschäftigungseffekte der Digitalisierung – Erste Eindrücke aus dem IW-Personalpanel, in IW-Trends, Jg. 42, Nr. 3, 77-94
2015
Hammermann, Andrea / Stettes,
Bewältigung von Stress in einer vernetzten Arbeitswelt – Befunde aus der BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung, IW-Trends 2/2015, 113-135
2015
Hardege, Stefan / Schmidt, Edgar,
Die Kosten des Kündigungsschutzes in Deutschland, IW-Analysen Nr. 41,
Köln 2008
Höttges, Timotheus,
Der Unterschied zwischen Mensch und Computer wird in Kürze aufgehoben sein, Interview in der ZEIT, 1/2016
2016
Hüsing, Tobias / Korte, Werner B. / Dashja, Eriona,
E-skills and e-leadership skills 2020 – Trends and forecasts for the European ICT professional and digital leadership labour market, empirica Working Paper May/2015,
Bonn 2015
IfM – Institut für Mittelstandsforschung Bonn, Statistisches Bundesamt (Hrsg.),
Der Selbstständigen-Monitor 2014,
Bonn 2015
ING-DiBa,
Die Roboter kommen. Folgen der Automatisierung für den deutschen Arbeitsmarkt, Economic Research,
April 2015
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung – IAB,
Befristete Beschäftigung – Aktuelle Zahlen aus dem IAB-Betriebspanel 2012, Aktuelle Daten und Indikatoren,
Nürnberg 2013
IW Consult / BITKOM,
Wirtschaft Digitalisiert. Welche Rolle spielt das Internet für die deutsche Industrie und Dienstleister?,
Köln 2013
IW Köln – Institut der deutschen Wirtschaft Köln / IW Consult,
Digitalisierung, Vernetzung und Strukturwandel: Wege zu mehr Wohlstand, Erster IW-Strukturbericht,
Köln 2015
IW Köln, 2016,
Betriebliches Gesundheitsmanagement - Fit am Arbeitsplatz, iwd, 42. Jg., Nr. 7, S. 1-2 h
Köln 2016
Jäger, Angela / Moll, Cornelius / Som, Oliver / Zanker, Christoph / Kinkel, Steffen / Lichtner, Ralph,
Analysis of the impact of robotic systems on employment in the European Union, Studie im Auftrag der Europäischen Kommission,
Luxemburg 2015
Kahneman, Daniel / Knetsch, Jack L. / Thaler, Richard H.,
Anomalies. The Endowment Effect, Loss Aversion, and Status Quo Bias, in: Journal of Economic Perspectives, Jg. 5, Nr. 1, S. 193-206
1991
Kromann, Lene / Skaksen, Jan Rose / Sorensen, Anders,
Automation, labor productivity and employment – a cross country comparison,
2011
Lesch, Hagen / Bennett, Jenny,
Arbeit und Fairness – Die Suche nach dem gerechten Lohn, IW-Analysen – Forschungsberichte Nr. 59,
Köln 2010
Lesch, Hagen / Mayer, Alexander / Schmidt, Lisa,
Das deutsche Mindestlohngesetz: Eine erste ökonomische Bewertung, IW policy paper 4/2014,
Köln 2014
Möller, Joachim,
Lohnungleichheit – Gibt es eine Trendwende, IAB-Discussion Paper 9/2016,
Nürnberg 2016
Niehues, Judith / Pimpertz, Jochen,
Alterssicherung der Selbständigen in Deutschland, in: IW-Trends, Jg. 39, Nr. 3, 17-34
2012
OECD,
ICT Skills and Employment, OECD Digital Economy Papers No. 198,
Paris 2012
OECD,
OECD Digital Economy Outlook 2015,
Paris 2015
OECD,
Strictness of employment protection (annual),
2016
Pimpertz, Jochen,
Bürgerversicherung – kein Heilmittel gegen grundlegende Fehlsteuerungen, IW policy paper 12/2013,
Köln 2013
PROGNOS,
Digitalisierung als Rahmenbedingung für Wachstum – update, Studie für die vbw,
München 2015
Schäfer, Holger / Schmidt, Jörg,
Einstieg in Arbeit – Die Rolle der Arbeitsmarktregulierung, IW policy paper 15/2014,
Köln 2014
Schäfer, Holger / Stettes, Oliver,
Gesetzesentwurf zur Regulierung von Zeitarbeit und Werkverträgen - Eine erste ökonomische Bewertung ausgewählter Eckpunkte des Referentenentwurfs aus dem Bundesarbeitsministerium für Arbeit und Soziales,
2015
Schäfer, Holger / Schmidt, Jörg / Stettes, Oliver,
Moderne Arbeitsmarktverfassung – Wie viel Regulierung verträgt der deutsche Arbeitsmarkt?, IW-Positionen – Beiträge zur Ordnungspolitik Nr. 66,
Köln 2014
SPD – Bundestagsfraktion,
Arbeiten 4.0 – Arbeits- und Sozialrecht an die Erfordernisse einer digitalisierten Arbeitswelt anpassen, Positionspapier vom 23.02.2016,
Berlin 2016
Statistisches Bundesamt, div. Jahrgänge,
Mikrozensus: Bevölkerung und Erwerbstätigkeit – Stand und Entwicklung der Erwerbstätigkeit in Deutschland, FS 1 R 4.1.1,
Wiesbaden
Statistisches Bundesamt,
Atypische Beschäftigung - Kernerwerbstätige nach einzelnen Erwerbsformen, Ergebnisse des Mikrozensus,
2011
Stettes, Oliver,
Der organisatorische Wandel – betriebliche Bildung, betriebliche Mitbestimmung und Entlohnungssysteme,
Hamburg 2004
Stettes, Oliver, 2007,
Effiziente Mitbestimmung – eine ökonomische Analyse, IW-Positionen Nr. 26,
Köln 2007
Stettes, Oliver,
Effiziente Personalpolitik bei alternden Belegschaften, IW-Positionen Nr. 44,
Köln 2010
Stettes, Oliver,
Betriebsräte und alternative Mitbestimmungsformen in der Industrie und deren Verbundbranchen, in: Sozialer Fortschritt, Jg. 59, Nr. 8, S. 199-209
2010
Stettes, Oliver,
Betriebsratswahlen 2010 – Eine Analyse auf Basis einer IW-Umfrage, in: IW-Trends, Jg. 38, Nr. 1, S. 19-33
2011
Wolter, Marc Ingo / Mönning, Anke / Hummel, Markus / Schneemann, Christian / Weber, Enzo / Zika, Gerd / Helmrich, Robert / Maier, Tobias / Neuber-Pohl, Caroline,
Industrie 4.0 und die Folgen für Arbeitsmarkt und Wirtschaft – Szenario-Rechnungen im Rahmen der BIBB-IAb-Qualifikations- und Berufsfeldprojektionen, IAB-Forschungsbericht 8/2015
2015
Worldrobotics,
executive summary,
2015
ZEW,
Branchenreport Informationswirtschaft. Konjunkturelle Stimmung. Aktuelle IKT-Trends. 4. Quartal 2014,
Mannheim 2015
Zwick, Thomas
Why Training Older Employees is Less Effective, ZEW Discussion Paper No. 11-046,
Mannhein 2011