Vertrauen in Hartz IV hat sich ausgezahlt
Seit Monaten wird eine Debatte über das Für und Wider von Hartz IV geführt. Anlass genug für Florian von Hennet, Pressesprecher der INSM, sich mit einem der Väter der Agenda-Reformen zu einem Interview zu treffen. Clement ist Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit a.D. und Kuratoriumsvorsitzender der INSM.
31. Januar 2019Hartz IV reformieren - aber wie?Warum Hartz IV erfolgreich ist
INSM: Was war der Auslöser, der zu dem führte, was wir heute als „Hartz IV“ kennen?
Wolfgang Clement: Auslöser war die Feststellung, die man auch schon früher hätte treffen können, dass wir bis 2005 nebeneinander mit zwei Sozialsystemen für erwerbsfähige Arbeitssuchende arbeiteten, nämlich der vormaligen Arbeitslosenhilfe und der Sozialhilfe, wobei aber in dem einen System – der Sozialhilfe – keine Arbeitsvermittlung stattfand. Insofern war es zwingend, die beiden Systeme für erwerbsfähige Menschen ohne Arbeit im Arbeitslosengeld II – seither leider „Hartz IV“ genannt - zusammenzuführen. Für die, die aus der Sozialhilfe kamen, hatte dies den Vorteil, dass sie nunmehr endlich in die Arbeitsvermittlung kamen und zudem kranken- und pflegeversichert wurden. Wir haben auf diese Weise einige hunderttausend Menschen in den Arbeitsmarkt geholt und in die Arbeitsvermittlung gebracht, in der die meisten von ihnen zuvor nie waren. Davon haben wir uns auch nicht abbringen lassen, als aufgrund der Zusammenlegung in einem Schritt die statistische Erfassung von Arbeitsuchenden explosionsartig anstieg und schließlich die 5-Millionen-Grenze überschritt. Das war natürlich ein Schockerlebnis, und es gehörte durchaus Durchhaltevermögen dazu, weiter auf die heilsame Wirkung der Maßnahmen zu setzen. Doch das Vertrauen hat sich, wie sich in den Folgejahren alsbald zeigte, ausgezahlt.
Sanktionen und Sperrzeiten gab es auch schon vor Ihren Reformen. Was war das Neue?
Wir haben den Grundsatz vom „Fördern und Fordern“ ganz konkret gemacht. Was heißt: Zur Arbeitsvermittlung gehören immer Zwei, der oder die Arbeitsuchende und die Vermittler. Sie sind auf Zusammenarbeit angewiesen, denn Vermittlung kann natürlich nur gelingen, wenn der Suchende mitwirkt. Wer öffentliche Förderung will, muss deshalb auch die damit verbundene Vermittlung nutzen, um so rasch wie möglich wieder auf eigenen Füßen stehen und arbeiten zu können. Öffentliche Förderung ist deshalb immer mit der gegebenenfalls einzufordernden Erwartung verbunden, dass die Vermittlung auch wahrgenommen wird. Also vor allem, dass ein angebotener, selbstverständlich legaler Arbeitsplatz oder eine Fortbildungsmaßnahme angenommen oder ein Vermittlungstermin auch wahrgenommen wird. Wer sich dem verweigert, muss mit angemessenen Sanktionen rechnen. Um diese Reform guten Gewissens konsequent angehen zu können, hatten wir zuvor die vormalige „Bundesanstalt“ in eine „Bundesagentur für Arbeit“ umgewandelt und die obrigkeitsstaatliche Anmutung durch die eines Unternehmens in öffentlicher Verantwortung ersetzt, das seine Kenntnis des Arbeitsmarktes und sein Ermessen der jeweiligen Gegebenheiten souveräner als früher wahrzunehmen in der Lage war und ist. Ich bin unverändert überzeugt, dass dies auch dem Engagement der Vermittlerinnen und Vermittler zugute gekommen ist, deren Arbeit wir überdies mit Pauschal- statt Einzelfallregeln zu fördern suchten.
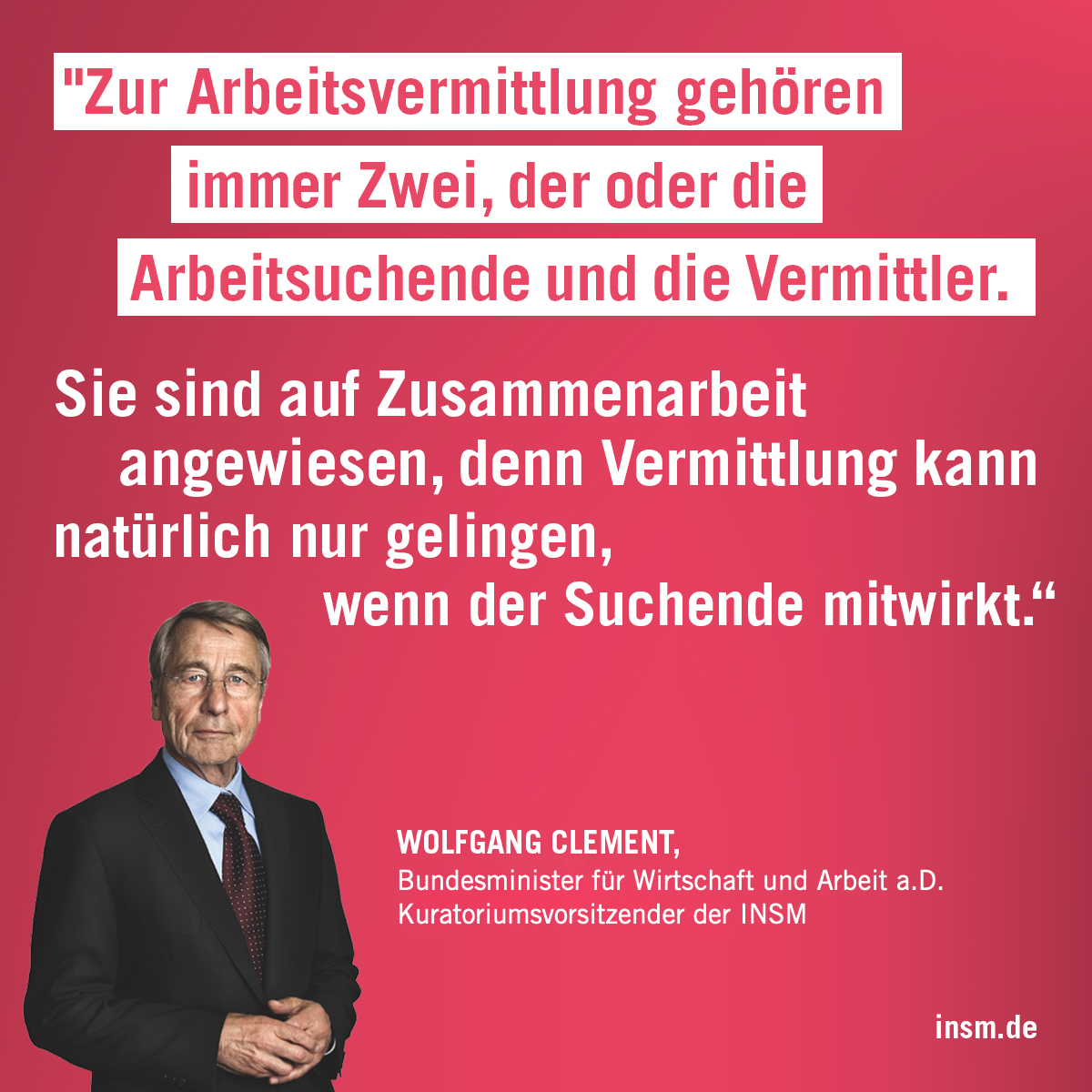
Woher kam der Vorschlag, die Sanktionen zu verschärfen: aus dem Ministerium oder aus der vom ehemaligen VW-Personalchef Peter Hartz geleiteten Kommission?
Der Grundgedanke kam aus der Kommission, aber wir haben das in unserem Verständnis in Gesetzesform gebracht. Peter Hartz hat sich ja seither mehrfach kritisch dazu geäußert und die Sanktionen als Bestrafungen bezeichnet. Mich überzeugt das nicht. Die Sanktionen, um die es hier geht, haben keine andere Funktion, als Vermittlungsarbeit, wenn irgend möglich, erfolgreich zu machen. Und das geht nur, wenn auch der zu Vermittelnde zur Zusammenarbeit bereit ist. Er oder sie trägt Verantwortung für sich und gegebenenfalls die ihm oder ihr Anvertrauten und auch dafür, die öffentliche Hand nicht mehr als notwendig in Anspruch zu nehmen. Sanktionen sind im Fall des Falles nichts Anderes als eine Aufforderung zu verantwortlicher Mitwirkung.
Sie hatten dann den Satz geprägt „Leistungsmissbrauch ist kein Kavaliersdelikt“. Sind Sie bis heute dieser Überzeugung?
Aber ja. Ich war damals alarmiert durch alle möglichen Missbrauchstatbestände, die es im Gefolge der erheblichen gesetzlichen Veränderungen gab. Es gab und gibt ja bis heute durchaus Versuche, ganz oder teilweise grundlos an öffentliche Mittel der Arbeitsförderung zu kommen, und es gab auch diverse andere Täuschungsversuche. Ich bin seinerzeit bekanntlich für meine Darstellung dessen, was geschah, wie auch sonst massiv kritisiert worden. Das will ich heute nicht wieder aufladen. Die heute in Rede stehenden Sanktionen gelten hingegen allein dem Ziel, die Arbeitsvermittlung im allseitigen Interesse erfolgversprechend handhaben zu können. Dass sie nur etwa 3 Prozent der Arbeitssuchenden betreffen, zeigt den Willen der ganz großen Mehrheit der Arbeitsuchenden, so schnell wie möglich der Arbeitslosigkeit zu entkommen.
SPD, Grüne und Linke wollen im Moment vor allem denen die Arbeitslosigkeit leichter machen, die sich nicht an die Vereinbarungen halten. Wenn man den Spieß gedanklich umdreht: Was müsste getan werden, um den fleißigen und ehrlichen Arbeitslosen zu helfen?
Man muss alles tun, um die Vermittlungsarbeit so erfolgreich wie möglich zu machen. Das wichtigste Mittel dazu ist, die Vermittlerinnen und Vermittler in den Jobcentern von überflüssiger Bürokratie zu entlasten. Denn sie sind heute mit bis zu 50 Prozent ihrer Tätigkeit mit dem Ausfüllen von Dokumenten und mit Aktenstudium und -arbeit beschäftigt. Der Grund ist das auch von Sozialgerichten gern geförderte Streben nach Einzelfallgerechtigkeit, statt – wie ursprünglich gesetzlich angelegt – auf großzügigere Pauschalregelungen zu vertrauen. Die steigern jedenfalls die Effektivität der Vermittlungsarbeit und führen so auch schneller in gerechtere Arbeitsverhältnisse.
Der Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, Heribert Prantl, hat geschrieben, dass Hartz IV das Kürzel für den Niedergang der SPD sei. Warum fällt es der SPD so schwer, von den Agenda-Reformen zu profitieren?
Die SPD hat sich durch ein ständiges Lamento über die von ihr auf mehreren Parteitagen und zahlreichen Regionalkonferenzen Paragraph für Paragraph diskutierte und beschlossene Agenda das Etikett „Hartz IV“ selbst aufgeklebt. Sie ignoriert so bis heute die Erfolge der Agenda 2010 und riskiert ihre Zukunftsfähigkeit. Denn sie hat nicht verstanden, dass den Arbeitsmarktreformen geradezu zwingend Bildungsreformen hätten folgen müssen. Das gilt übrigens weiterhin – und nicht nur für die SPD. Bildungspolitik vom Kindergarten über die Schulen, die Berufs- und die Hochschulen bis zur Weiterbildung ist die beste Arbeitsmarktpolitik. Nichts ist wichtiger. Wir brauchen deshalb keine Agenda-2010-Reform, sondern eine umfassende Bildungs-Agenda. Wir müssen das föderale Tohuwabohu zwischen Bund und Ländern in der Bildung beenden. Und wir müssen endlich zur Kenntnis nehmen, dass wir mit den heutigen finanziellen Mitteln von Bund, Ländern und Gemeinden nach den Feststellungen der OECD um jährlich etwa 30 Milliarden Euro weniger in unsere Kindergärten, Schulen und Hochschulen investieren als der OECD-Durchschnitt. Das zu ändern, das ist Arbeitsmarktpolitik, die sich auf der Höhe der Zeit und der Herausforderungen von heute bewegt.
Das Bundesverfassungsgericht befasst sich im Moment mit den Hartz IV-Reformen. Mit welchem Ausgang rechnen Sie?
Ich hoffe auf eine klare Bestätigung des Grundsatzes vom Fördern und Fordern, der unsere Arbeitsmarktpolitik trägt und prägt. Ich rechne deshalb auch nicht mit grundlegenden Veränderungen bei den Sanktionen. Was ich mir wünsche, das ist mehr Vertrauen in die Arbeit der Vermittlerinnen und Vermittler. Es würde mich freuen, und es wäre für die Arbeit in den Jobcentern gewiss hilfreich, wenn unser höchstes Gericht hier ein Zeichen setzte.

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, 2018
Was ist für Sie der größte Erfolg der Reformen?
Dass unser Arbeitsmarkt heute so dasteht wie er ist: Die geringste Jugendarbeitslosigkeit in ganz Europa, die allgemeine Arbeitslosigkeit halbiert, die Langzeitarbeitslosigkeit ebenfalls, Vollbeschäftigung in nicht geringen Teilen unseres Landes und die höchste Erwerbstätigenquote seit je. Dazu haben die weltwirtschaftliche Entwicklung seit der großen Finanzkrise und Anderes mehr beigetragen. Aber die Arbeitsmarktreformen der Agenda 2010 haben daran nach ganz überwiegender Expertenmeinung gehörigen Anteil. Deshalb verfolge ich die Korrekturdiskussionen mit einiger Skepsis, sehe ihren Sinn eigentlich nur im Bereich der Zuverdienstmöglichkeiten für Geringverdiener, ohne dass ich einen überzeugenden Lösungsvorschlag benennen könnte.
Was würden Sie heute anders machen. Welche Reform hätte von Anfang an stärker mit eingeplant werden müssen?
Da bin ich wieder beim Thema Bildung. Wir haben damals wenigstens dessen Bedeutung und auch schon die Schwächen in der schulischen Praxis erkannt und erstmals überhaupt Geld aus der Bundeskasse in die Hand genommen – es waren wohl vier Milliarden Euro für Ganztagsschulen – die wir den Ländern zur Verfügung stellten. Nach allem, was wir heute wissen, nicht zuletzt aus international vergleichenden Studien des Bildungswesens, hätten wir schon früher und mehr tun müssen. Heute allerdings ist eine Vernachlässigung des Erneuerungsbedarfs in unserem Bildungswesen nicht mehr tolerabel.

Wolfgang Clement
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit a.D. und Kuratoriumsvorsitzender der INSM